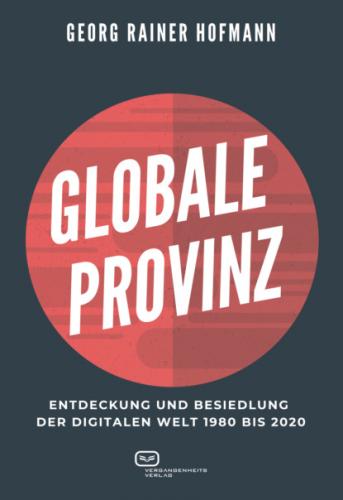GLOBALE PROVINZ. Georg Rainer Hofmann
für das Exponat für die Ausstellung her, also digitale Bilder, farbige Rasterbilder, die aus Pixeln aufgebaut waren. PADL konnte so etwas als »shaded pictures« berechnen und in einer Auflösung von 512 mal 512 Bildpunkten in einer Datei abspeichern.
Titel der Springer-Publikation »Rasterbild-Bildraster« vom Sommer 1986.
Sehen oder zeigen konnte man so ein Bild, einen »Frame«, damit noch lange nicht. Die Datei mit dem Rasterbild wurde dann vom Siemens-Zentralrechner per Telefonmodem auf einen Spezialrechner bei GRIS übertragen, und in einem »frame buffer« gespeichert. Daran war ein Farbmonitor angeschlossen und man konnte – bitte sehr! – das Bild endlich wirklich sehen. Denn dieser Monitor, mit einer klassischen Braunschen Röhre ausgestattet, konnte tatsächlich ein farbiges Rasterbild darstellen. Normale Computermonitore zeigten nur Zeichen monochrom in Grün oder Orange. Das Ganze kostete pro Frame leicht mehrere Stunden Aufwand. Bilder für die Ausstellung brauchten aber noch eine »Hardcopy« – zum An-die-Wand-Hängen.
Für ausstellungsfähige Bilder wurde eine 35-mm-Kleinbildfilm-Fotokamera mit Teleobjektiv auf einem Stativ in einiger Entfernung vor dem Monitor platziert. Das Teleobjektiv milderte die kugelförmige Verzeichnung des Bildschirms. Das Stativ brauchte man, weil es einige Sekunden Belichtungszeit pro Aufnahme benötigte, um das Flimmern des Monitors zu eliminieren. Und so wurden Foto-Negative und auch Vortragsdias unserer Rechenergebnisse fabriziert. Es gab ja noch keine Beamer oder gar große LED-Monitore, also projizierte man in der Symmetrie-Ausstellung eine Diashow mit klassischen Projektoren auf eine Leinwand. Ein Übernehmen der Bilder in ein digitales Dokument, etwa als Abbildung in einer Textdatei, war damals noch völlig utopisch. Das wurde erst möglich mit der Entwicklung der »Architekturen Offener Dokumente« (ODA), wie sie im Kontext des BERKOM-Projekts einige Jahre später erfolgen sollte.
Für das Erstellen von Diaschau-Bildern mit »Textelementen«, Schrift oder Formeln, wurde die mit einem Laserdrucker ausgedruckte entsprechende Papierseite mit schwarzer Schrift auf einem Repro-Fototisch durch ein Gelbfilter aufgenommen. Das 35-mm-Negativ zeigte dann weiße Schrift auf blauem Grund. Dieses Negativ konnte im Vortag wiederum quasi als ein Dia gezeigt werden. Und dieses »Weißauf-Blau«-Schriftbild war damals schon schick. Wegen des Raffael-Projekts war ich quasi »ständig« im Institut GRIS. Professor Encarnação genehmigte mir sogar einen Büroarbeitsplatz mit einem eigenen Telefon auf dem Schreibtisch. Das Telefon war bis zur Mitte der 1980er-Jahre wohl das wichtigste Kommunikationsmittel im Büro. Es hatte eine Wählscheibe und war grau – das Fabrikat »Siemens FeTAp 611« hieß daher auch die »Graue Maus«. Dieser Büroarbeitsplatz mit Telefon war ein damals fast unglaubliches Privileg für einen Hiwi-Studenten.
In der Rückschau fällt das fast »niedlich« zu nennende Arbeits- und Prozess-Tempo in der Mitte der 1980er-Jahre auf. Man hatte an einem normalen Arbeitstag eine um Längen geringere Ereignis- und Termindichte zu bewältigen als dies viele Jahre später der Fall war. Das Telefon war das einzige Echtzeit-Medium, die Briefpost hatte eine Reaktionszeit von einigen Tagen. Das Telefax war noch nicht alltäglich und überall in Gebrauch. Drängte ein Kooperationspartner auf eine versprochene Zuarbeit, so konnte man ihn am Telefon vertrösten, das sei schon in der Post. Und man hatte noch den ganzen Tag Zeit, es wirklich zu erledigen und zur Post zu geben.
Einige der Begleitumstände waren unglaublich provinziell und idyllisch, verglichen mit der »around the clock action«, die die entwickelte Informationsgesellschaft Jahrzehnte später mit sich bringen sollte. Gegenüber des Instituts GRIS in Darmstadt gab es eine Gaststätte »Bayerischer Hof«. Setzte man sich dort zur Mittagszeit an einen Tisch, so wurden ohne Bestellung die Tagessuppe und ein halber Liter Bier – eine »Halbe« – gebracht. Dann gab es ein warmes Tellergericht nach Speisekarte. So eine Mittagspause konnte schon mal gut zwei Stunden dauern. Der Nachmittag hatte, abhängig von der Zahl der zu Mittag konsumierten »Halben«, manchmal eine geradezu lässige Grundstimmung.
Das Darmstädter Raffael-Projekt zeigte mithilfe der Perspektivenwechsel in der synthetischen dreidimensionalen Szene, dass Raffaels Fresko zwei Perspektiven aufweist, die allerdings den gleichen Fluchtpunkt, aber eine verschiedene Tiefenskalierung haben. Dadurch entsteht eine Dynamik die den Betrachter quasi in das Bild »hineinzieht«. Professor Encarnação erreichte im Sommer 1986 beim Springer-Verlag in Heidelberg, dass dort eine Monographie zu unserem Raffael-Projekt erschien. Sie hieß »Bildraster-Rasterbild – Anwendung der Graphischen Datenverarbeitung zur geometrischen Analyse eines Meisterwerks der Renaissance: Raffaels Schule von Athen«. Die Autoren waren Guerino Mazzola, Detlef Krömker und ich – obwohl ich ja erst ein Student war. Unser Ansprechpartner beim Springer-Verlag war übrigens Gerd Rossbach. Er sollte ab dem Jahr 1992 die ersten »Deutschen Multimedia Kongresse« (DMMK) initiieren.
Bilder vom Raffael-Projekt der Darmstädter Symmetrie-Ausstellung aus dem Jahr 1986. Szenenmodell und Holzpuppen, die vermessen wurden, und ihre Modellierung und Visualisierung mit dem PADL-2-System.
In der Kulturszene waren wir bei einigen professionellen, aber reaktionären Kunsthistorikern quasi »unten durch«. Möglicherweise waren sie gereizt, weil sie erkennen mussten, dass ihre Unkenntnis der Mathematik und Geometrie, mit der sie manchmal gar kokettierten (»in Mathe hatte ich immer eine Fünf«), hier ein wirklicher Nachteil war. Sie verstanden einfach nicht, um was es bei der »Schule von Athen« ging und spürten, dass sie den geometrischen Fähigkeiten eines Raffael absolut nicht gewachsen waren. Das ärgerte sie. So durften wir von völlig Ahnungslosen verfasste Pressetexte lesen, dass wir »Raffaels großartiges Fresko zu einer unsäglichen Badeanstalt« hätten verkommen lassen. Um uns als Techniker generell zu diskreditieren, überschrieb man einen Zeitungsartikel gar mit: »Von Holzpuppen und Holzköpfen«. Viele Jahre später hätte man das wohl ein »hate posting« genannt.
Einige Monate nach dem Ende der Symmetrie-Ausstellung sollte Anfang April 1987 die große Tagung »Datenbanksysteme in Büro, Technik und Wissenschaft« (BTW) der »Gesellschaft für Informatik« (GI) in Darmstadt stattfinden. José Luis Encarnação war eingeladen worden, zur feierlichen Abendveranstaltung den akademischen »Dinner Speech« zu halten, im Festsaal der Darmstädter Orangerie vor mehreren Hundert Zuhörern. Aber Encarnação passed it over to me. »Hofmann, gehen Sie da hin! Sie haben doch diese Raffael-Bilder, damit können Sie einen Vortrag halten.« Er meinte, so eine Aufgabe fiele mir doch sicher ganz leicht. Ich hingegen konnte angesichts der anspruchsvollen Aufgabe und den Erwartungen der Zuhörerschaft schon leicht nervös werden. Die BTW-Teilnehmer rechneten ja mit dem renommierten Professor Encarnação als Redner – und sicher nicht mit einem Studenten, der ihnen irgendwelche von einem Monitor abfotografierte bunte Dias zeigen würde.
Es war wohl so etwas wie mein »Bundesliga-Debut«. Ich war 25 Jahre alt und trug zur BTW-Abendveranstaltung einen Anzug mit Krawatte. Detlef Krömker hatte mir noch mitgegeben: »Lerne die ersten paar Sätze des Vortrags auswendig. Das darf den Zuhörern aber nicht auffallen. Ist erst mal der Anfang gut gegangen, dann läuft der Rest auch. Dann kann kommen, was will«. Der Anfang ging gut, und so lief der ganze Vortrag generell ganz gut. Eine gemeinsame Intentionalität mit dem Publikum war spürbar, und es gab großen Applaus. Bei der Darmstädter BTW-Tagung waren im Publikum die fortschrittlichen Kräfte offenbar in der Überzahl. A small step for mankind, a giant leap for a man.
Ein Merkmal der entwickelten Informationsgesellschaft ist die Ubiquität und Selbstverständlichkeit von digitalen Bildern. So gesehen stand das Raffael-Projekt am Anfang einer fabelhaften Entwicklung, nämlich der Popularisierung der Computergraphik und des Computergraphischen Realismus. Ein Zeichen dieser beginnenden Popularisierung sollte in den Jahren 1987 bis 1989 eine quasi »Deutschland-Tournee« sein, die dem Auftritt an der BTW-Tagung folgte. Ich erhielt viele Einladungen zu Vorträgen, das Raffael-Projekt zu präsentieren.
Professor Dr.-Ing. Dr. h.c. Dr. E.h. José Luis Encarnação, Darmstadt und Berlin