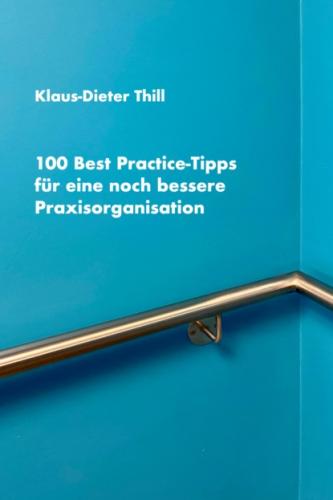100 Best Practice-Tipps für eine noch bessere Praxisorganisation. Klaus-Dieter Thill
denn in jeder Arztpraxis finden sich durchschnittlich achtzehn (!) Verbesserungsmöglichkeiten der Organisation. Der Grund hierfür liegt in einem grundsätzlichen Irrtum, dem die meisten Mediziner unterliegen: wenn sie ihre Organisation verbessern möchten, suchen sie nach einer „großen Lösung“, d. h. nach einem Ansatz oder Konzept, mit dessen Umsetzung eine umfassende Optimierung erreicht werden kann. Doch die Tücke der Materie liegt in der Tatsache, dass dieser umfassende Ansatz nicht existiert, sondern es vielmehr auf ein Zusammenwirken vieler kleiner, einzelner Stellgrößen ankommt. Die wichtigsten sind in diesem Buch, thematisch sortiert, zusammengefasst.
Hierbei handelt es sich um praktische, alltagsbewährte Tipps zu organisatorischen Regelungen. Sie stammen zum größten Teil von niedergelassenen Ärzten, die ihre Praxisorganisation Best-Practice-orientiert entwickelt haben. Sie werden ergänzt durch grundlegende, Organisations-fördernde Erkenntnisse aus Praxisanalysen. Alle Tipps geben Ihnen Anhaltspunkte, wie Sie mit guter Organisation Zeit und Kosten sparen können, die Produktivität erhöhen, eine bessere Arbeitsqualität (Stichwort: Work-Life-Balance) erreichen und insgesamt erfolgreicher sind.
1 Praxisorganisation: Die Erfolgs-Stellschraube einer „guten Arztpraxis“
1.1 60:40
Diese beiden Prozentwerte charakterisieren die gegenwärtige Leistungsfähigkeit der Organisation in deutschen Arztpraxen. In Praxisbetrieben werden - wie die Ergebnisse der Praxisanalysen unseres Instituts zeigen - durchschnittlich nur knapp 60% (57,4%) der Instrumente, Verfahren und Regelungen eingesetzt, die für eine optimal funktionierende Organisation notwendig sind. Dieses niedrige Einsatzniveau hat auch eine unmittelbare Konsequenz: es führt dazu, dass im Mittel auch nur 40% (38,9%) der Anforderungen, die Patienten an eine ihren Vorstellungen entsprechende Praxisorganisation stellen, tatsächlich erfüllt werden.
1.2 Ärzte kümmern sich nur wenig um die Organisation
Die Leistungsqualität einer Arztpraxis wird maßgeblich durch die Güte der Praxisorganisation bestimmt. Ihre Justierung beeinflusst alle Arbeitsbereiche und Erfolgs- bzw. Zustandsgrößen wie z. B. Produktivität, Patientenzufriedenheit, Stressbelastung oder wirtschaftlichen Erfolg. Nach medizinischer Versorgung und Betreuungsqualität ist die Praxisorganisation für Patienten das drittwichtigste Kriterium bei der Beurteilung von Arztpraxen und damit ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.
Doch viele Ärzte kümmern sich leider zu wenig um die Organisationsqualität. Ein Beispiel hierfür: bislang hat nur ein Drittel der Praxisinhaber eine Organisationsanalyse durchgeführt, um die Funktionalität, Patienten-Eignung und vor allem mögliche Rationalisierungs- und Veränderungsmöglichkeiten zu bestimmen. Vor allem Befürchtungen in Bezug auf einen zu großen Zeitaufwand und vermutete hohe Kosten halten sie ab. Das Resultat ist eine Vielzahl von Defiziten, die den Arbeitsalltag negativ prägen. Im Mittel lassen sich in einer Arztpraxis achtzehn Ansätze für organisatorische Verbesserungen finden. Zu den häufigsten zählen folgende Punkte:
- Fehlende Pufferzeiten
- "Einschieben" von Patienten ohne Termin
- Unsystematische Mischung von Kurz- und Lang-Terminen
- Unzureichende Aufgabenzuordnung, geringe interne Kommunikation
- Unpünktlichkeit des Arztes
- Geringe Abstimmung des ärztlichen Zeitmanagements mit den Praxisabläufen
- Arzt-Patienten-Kontakte am Empfang, auf dem Gang und im Wartezimmer
- Zu geringe Informations- und Delegations-Intensität
- Häufige Störungen des Arzt-Patienten-Gesprächs.
1.3 Unzureichende Organisation ist multifaktoriell bedingt
Aufgrund eines fehlenden Einblicks in die notwendigen organisatorischen Grundregeln ist vielen Ärzten und Medizinischen Fachangestellten gar nicht bewusst, über welche Reserven sie verfügen. So arbeiten manche Praxisbetriebe am Limit oder bereits darüber, sehen aber keinen Ausweg und erklären sich die Situation durch den wachsenden administrativen Aufwand.
Aber auch Praxen, die nach eigener Einschätzung gut funktionieren, besitzen durchaus noch ungenutzte Reserven, von denen sie selbst und ihre Patienten profitieren könnten.
Darüber hinaus existieren in vielen Praxen Organisations-Defizite, die sich akut noch nicht negativ auswirken, langfristig aber Probleme verursachen werden.
Hinzu kommen Fehlsteuerungen in anderen Praxismanagement-Aktionsbereichen, die sich auf die Organisation auswirken. Werden beispielsweise ernste Konflikte im Praxisteam nicht gelöst, wirkt sich dieser Zustand negativ auf die Zusammenarbeit und damit auch auf Organisationsprozesse aus. Ist z. B. die Telefonanlage nicht auf die Quantität der Anrufe ausgelegt, resultieren auch hieraus ernsthafte Organisationsprobleme.
1.4 Welcher Organisations-Typ sind Sie?
Patienten werten schlechte Organisation als Unfähigkeit des Praxisteams, denn gut funktionierende Abläufe werden in gleichem Umfang erwartet wie gute Medizin. Die wohl wichtigste Beurteilungsgröße der Organisationsqualität ist für Patienten die Länge der Wartezeit. Entscheidend für die Zufriedenheit ist hierbei nicht die absolute Länge des Wartens, sondern das Verhältnis zu Länge und Qualität des Arztkontaktes. Doch diese Gesetzmäßigkeit beachten nur die wenigsten Praxisinhaber. Stellt man die Länge der Wartezeit und die Dauer des Arzt-Patienten-Gesprächs einander gegenüber, lässt sich eine die Realität sehr gut beschreibende Typologie für Praxisinhaber entwickeln:
- Die Optimierer (ca. 5% der Ärzte) haben ihre Abläufe systematisch entwickelt und strukturiert. Sie sind in der Lage, den unterschiedlichen Zeitanforderungen der Patienten gerecht zu werden und gleichzeitig ihre Praxisziele zu erreichen. Durch kontinuierliche Analysen und Kontrollen halten sie ihre Organisationssysteme im Form.
- Das Gegenteil sind die Indifferent-Planlosen (ca. 40%). Sie kümmern sich nicht um organisatorische Effizienz oder Patientenwünsche, sondern reagieren aktionistisch auf die täglichen terminlichen Anforderungen der Praxisarbeit. Auch ihr persönliches Zeitmanagement folgt keinen Regeln, sondern spontanen Eingaben, z. B. in Form längerer Privatgespräche mit Patienten.
- Die Akkord-Therapeuten (ca. 25%) sind Optimierer ohne Patientenorientierung. Sie versuchen, das medizinisch Notwendige in so kurzer Zeit wie nur möglich zu erledigen. Informationen erhalten die Patienten von ihnen kaum.
- Die Unorganisierten Kümmerer (ca. 30%) stellen wiederum die Patienten in den Mittelpunkt, vernachlässigen aber dabei die Praxisorganisation. Wer zu ihnen geht, muss überlange Wartezeiten in Kauf nehmen, erhält dafür aber das Maximum an Aufmerksamkeit, Zuwendung und Hilfe.
1.5 Ein erster Überblick zur Fehlersuche und -beseitigung
Wo liegen die Hauptprobleme der organisatorischen Gestaltung des Praxisbetriebs? Die Ergebnisse einer Untersuchung von Arztpraxen, die nach eigenen Angaben mit Termin-Bestellsystemen arbeiten, gibt Aufschluss. Einschlußkriterium war eine Erfüllung der Patientenanforderungen (Zufriedenheit mit den erfragten Leistungsmerkmalen in Prozent der Wichtigkeit) von weniger als 50%. Die Ergebnisse: als Durchschnittswert für die Patientenzufriedenheit mit der Praxisorganisation konnte für die analysierten Praxen die Note 4,7 (Basis: Schulnoten-Skalierung) ermittelt werden. Folgende Fehlsteuerungen der Praxisorganisation waren hierfür in der Hauptsache (Auftrittshäufigkeit > 70%) verantwortlich:
(1) Missbrauch der Pufferzeiten: in 2/3 der Praxen fehlen Pufferzeiten vollständig, in den übrigen Betrieben werden sie nur teilweise beachtet und für die Eingliederung von Patienten ohne Termin verwendet.
(2) Unzureichende Aufgabenkoordination: es gibt keine Abstimmung der Tätigkeiten innerhalb des Praxisteams, so kommt es zu Doppel- oder Nicht-Erledigungen.
(3) Schlechte interne Kommunikation: der Informationsfluss ist nicht geregelt und institutionalisiert.