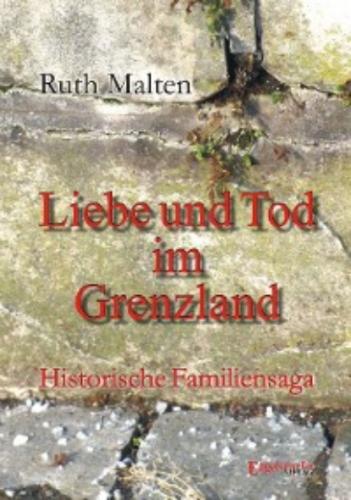Liebe und Tod im Grenzland. Ruth Malten
und war von dem Duft des Geflechts und Garnes wie berauscht. Sie fand hier ihr Steckenpferd, eine lebenslange Quelle von Freude und auch Trost in schweren Tagen, die noch kommen sollten. Als sie stricken lernte, wurde das zu einer Leidenschaft, die alle anderen Betätigungen auszulöschen drohte. Sie musste sich Grenzen setzen.
Hermine hatte das Gefühl, in der Stadt aufzublühen. Hier konnte sie die eleganten Röcke und Blusen, die modischen Hüte und ausgefallenen Schuhe tragen, die ihr gefielen, ohne dass abfällig geflüsterte Bemerkungen der Nachbarinnen oder deren missbilligende Blicke ihr die Freude daran verdarben.
Einen Wermutstropfen gab es dennoch: Äußerte sie ihrem Kaufmann ihre Wünsche, geschah es nicht selten, dass Kundinnen neben ihr unversehens die Hand vor den Mund hielten, sich abwandten, heimlich kicherten, oder sich verdutzt schmunzelnd mit hoch gezogenen Augenbrauen vielsagende Blicke zuwarfen. Zuweilen musste sie ihren Satz mehrfach wiederholen, weil die Verkäuferin sie nicht verstanden hatte. Acht Jahre einklassige Volksschule im tiefsten dörflichen Sachsen machten ihr hier zu schaffen.
Sie mühte sich zwar, Hochdeutsch zu reden, aber was war hier Hochdeutsch? Die Einheimischen sprachen ihr spezielles Schlesisch, so wie Hermine ihr heimatliches Sächsisch. Hinzu kam, die Breslauer, im Allgemeinen offen und zutraulich, konnten zu ‚Lergen‘ werden, flinkzüngigen Frechdachsen, die loszankten, wenn man ihnen vermeintlich dumm- kam. Dann wurde drauflos gewettert, eher laut als leise, mehr Rotwelsch als Hochdeutsch. Ein Wortschwall dieser Art, ungefiltert und unbereinigt, konnte eine ahnungslose sächsische Einwanderin durchaus erschüttern. Hermine hatte bald herausgefunden, wie sie solchen Biestereien am besten entkam: Mund halten statt mit zu zetern. Ein großer Lernschritt für Hermine, die Disputen – vorrangig in ihrem Großröhrsdorfer Sächsisch – bisher nicht aus dem Weg gegangen war, im Gegenteil, sie liebte leidenschaftliche streitige Debatten.
Hin und wieder brachte Gustav, der durch intensiven Kundenkontakt mit Menschen unterschiedlicher Dialekte in Verbindung kam, eine hochdeutsche Vokabel mit nach Hause. Zum Beispiel erklärte er Hermine, spitzbübisch schmunzelnd: „Es heißt nicht ‚die Sollote‘, mit Betonung auf der ersten Silbe, wie in Großröhrsdorf, auch nicht Solload, wie in Breslau, sondern ‚der Salat‘.“ Auch Sohn Arthur korrigierte mehr und mehr seine Hintersächsisch sprechenden Altvorderen. Dieses Thema war für die Familie jedoch eher eine Lachnummer. „Es gibt Wichtigeres als Hochdeutsch“, fand Gustav.
Aus der Schule bringt Arthur die Neuigkeit mit, der preußische Kriegsminister von Heeringen warne vor Verweichlichung der Jugend und empfehle vormilitärische Ausbildung. Auf Anregung von Generalfeldmarschall von der Goltz werde der halbstaatliche Jugenddeutschlandbund gegründet, der vormilitärischen Sport pflegen und die körperliche und sittliche Erziehung der Jugend im vaterländischen Geist gewährleisten solle. „Klingt doch gut, oder?“, bemerkt Arthur fragend zu seinem Vater hin. Gustav schaut seinen Sohn durchdringend mit seinen blauen Augen an, als wolle er ihn durchbohren: „Hoffentlich geht’s dabei wirklich um das Wohl der Jugend. Klingt in meinen Ohren verdammt nach politischer Säbelrasselei“, entgegnet er, skeptisch wie immer.
Paul und Arthur sind Stammgäste in der Städtischen Bücherei. Arthur entleiht nach und nach alle Bände seines sächsischen Landsmannes Karl May. Paul liebt Werke der Geschichte und Klassik. Gegenwärtig liest er den ‚Kampf um Rom‘ von Felix Dahn. Als die beiden Lieblings-Autoren 1912 sterben, Felix Dahn in Breslau, empfinden die beiden Brüder Trauer, als seien gute Freunde von ihnen gegangen.
Da Paul Musik liebt und sich insbesondere zu klassischer Musik hingezogen fühlt, meldet ihn Hermine für Geigen-Unterricht bei Selma Havel an. Die Adresse las sie in der Tageszeitung. Das Lesen der Noten ist für Paul der eingeschränkten Sehfähigkeit wegen nicht einfach. Da er sich jedoch vom ersten Unterrichtstag an stark zu Selma Havel hingezogen fühlt, gibt er sich große Mühe und kann mit den anderen fünf Kindern der Gruppe mithalten.
1913 erfüllt sich Gustav einen lang gehegten Traum: Er kauft sein erstes Auto, einen Audi von Firma Horch in Zwickau.
Die Familie steht staunend um das seltsame Gefährt. Arthur bemerkt: „Sieht aus, wie Opas Lehnsessel auf Drahträdern.“ Paul wundert sich über die Scheinwerfer, die fast frei in der Luft zu schweben scheinen, bei näherem Betrachten jedoch mit dünnen Metallröhren miteinander verbunden und mit weiteren dünnen Stäben an der Kühlerhaube befestigt sind. Hermine betrachtet das Firmen-Emblem: „Schaut mal, wie ein Reiher im Flug.“ Bei näherem Hinschauen zeigt sich lediglich ein windschnittiges Flügelpaar, rückwärtig von einem vorwärts gerichteten Pfeil durchbohrt, den Eindruck blitzartiger Schnelligkeit vermittelnd.
Andere Kinder, auch Erwachsene sind hinzugekommen und betrachten das Kraftfahrzeug bewundernd und beeindruckt. Arthur, Paul und Ilse sind stolz auf ihren Vater, der mit seinem Fahrzeug derart im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit steht.
Seine erste längere Tour unternimmt Gustav, um Arno, seinen Schulfreund aus Großröhrsdorf, zu besuchen, der sich in Allenstein im Ostpreußischen als Schreiner selbständig gemacht hat und ihn vor Monaten einlud. Ein Satz aus Arnos Brief hämmert beschwingt in Gustavs Hinterkopf: „In meiner Nachbarschaft gibt ein Baustoffunternehmer aus Altersgründen auf. Da er keinen Erben hat, sucht er einen Nachfolger.“ Noch ahnt seine Familie nichts von diesem Satz und Gustavs tief im Herzen verborgener Faszination.
Die Familie steht um den Horch und bewundert den Mut des Vaters, mit diesem fremdartigen, knatternden und seltsam stinkenden Gefährt eine so weite Reise allein aufzunehmen. Zwar ist Gustav aufgeregt, aber seine Augen strahlen, sein Kopf ist vor Freude gerötet und er lacht begeistert, als er sein erstes Auto lautstark startet und die Familie ängstlich und stolz, fröhlich und besorgt hinter ihm herwinkt.
4. Kapitel
Elise organisiert ihr Leben mit Emma neu
Elise fand eine Hilfe für die Versorgung des Babys am Tage. Frau Rösler, Witwe ohne eigene Kinder, war dankbar, erneut einen kleinen Menschen aufzuziehen zu dürfen. Die große, vollschlanke Frau mit Wangengrübchen, blauen Augen, schlicht rückwärts gekämmten und in einem Knoten verschlungenen silbergrauen Haaren strahlte Wärme und gelassene Heiterkeit aus. „Willkommen auf unserer Erde, kleine Emma“, sagte sie sanft und neigte sich dem Baby zu, das in einem von Elise mit geblümtem Batist bespannten Körbchen lag. Lächelnd erwiderte der Säugling ihren Blick, mit Armen und Beinen lebhaft ruckelnd. „Was für ein feines, zartes Kind Du bist.“ Emma krauste die Stirn, schürzte die Lippen und schob die kleine Faust in den Mund. Elise nahm ihr Baby aus dem Korb und schmiegte ihr Gesicht an seinen Hals. Dieser Duft nach Milch, Haut und Baby! Ihr fielen keine Worte ein für diesen unvergleichlichen Wohlgeruch. Sie hätte ohne Ende ihren Säugling beschnuppern mögen. Frau Rösler stand daneben, ihre Augen umrankt von freundlichen Knitterfältchen, das Gesicht heiter und in Vorfreude, diesen Sprössling bald ganze Tage bei sich zu haben.
Kam Elise morgens in den Friseur-Salon und grüßte mit einem munteren „Guten Morgen“ ihre Kolleginnen und wartende Kunden, erhellten sich die Gesichter.
Während ihre heutige Kundin noch beschrieb, welche Frisur ihr vorschwebte, wog Elise deren Haar in der Hand, prüfte kundig Gesicht und Kopfform. Sie bewegte das Haar in unterschiedlicher Weise, experimentierte und prüfte, während sie mit der Kundin redete. Nach einer Entscheidung arbeitete sie konzentriert und plauderte dennoch scheinbar entspannt. Elise war beliebt, hatte einen beachtlichen Kreis von Stammkunden und eine zufriedene Chefin.
Als Elise am Abend das Haus betritt, in dem sie wohnt, empfängt sie im Flur ein aufdringlicher Geruch nach Kohl. Die Böttchers in der ersten Etage lassen oft ihre Wohnungstür zum Hausflur hin offen. So riecht im Haus jeder Eintretende, was bei Böttchers am Abend auf dem Tisch stehen wird, heut offenbar Weißkohleintopf. Im Vorbeigehen hört Elise unfreiwillig, wie die beiden Eheleute, Heini und Lena, wieder einmal lautstark zanken. Erneut geht es ums Geldausgeben. Lena hat im Resteladen Stoff für Küchengardinen gekauft, genäht und gehofft, Heini würde sich darüber freuen. Aber er dröhnt, wofür in Drei-Teufels-Namen in der Küche Gardinen hängen müssen. „Ich habe nicht in der Lotterie gewonnen, heiliger Strohsack“, donnert er, und Lena äußert flennend, enttäuscht und wütend Unverständliches.
Elise braucht