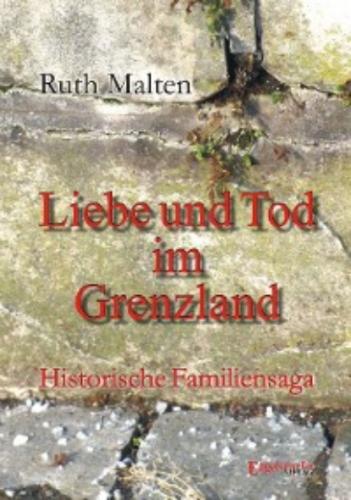Liebe und Tod im Grenzland. Ruth Malten
der Ofen erst angeheizt, wenn Emma und ihre Kolleginnen eintreffen. Wer weiter entfernt vom Ofen arbeitet, darf sich ab und zu aufwärmen. Immer weniger Holz oder Kohle wird für einen Tag eingeplant. Die Mitarbeiter telefonieren, schreiben, schneiden zu, nähen an Maschinen, packen aus oder ein, bekleidet mit Mantel, Schal und Mütze. Das findet im Laufe des kalten Winters niemand mehr komisch. Kalte Füße und Hände, trockenes Brot, allenfalls auf dem Kanonenofen im Betrieb geröstet. Immer trübsinniger wird die Stimmung.
Eines Tages teilt der Chef, Herr Meier Senior, den Mitarbeitern mit, dass zwar die Aufträge noch hereinkommen, aber viele nicht mehr bedient werden können. Ohne importierte Stoffe keine Anzüge, Jacken und Mäntel. „Unsere Produkte sind hochpreisig“, sagt er. „Die Kunden im Inland gehen uns nach und nach aus. Die ausländischen können wir wegen der Seeblockade nicht mehr beliefern. Unsere Vorräte an Stoffen gehen zur Neige.“
Grabesstille umgibt ihn. Die Angst und Beklommenheit in den Gesichtern der Arbeiter und Angestellten ist kaum zu ertragen. Dem alten Herrn fällt es offensichtlich schwer, fortzufahren. Er räuspert sich wiederholt, fährt mit der Hand durch sein silbergraues Haar, und vermeidet, den Getreuen vieler Jahre in die Augen zu sehen, als er mit leiser, zerbrechender Stimme weiterspricht: „Ich will es nicht. Aber ich muss.“ Die Pausen zwischen seinen kurzen Sätzen werden immer länger. Immer öfter räuspert sich der alte Herr. „Ich muss verkleinern. Noch deutlicher: Einige von ihnen werden uns verlassen müssen. Eine Lockerung der verschärften Handelsbedingungen durch die Engländer ist in nächster Zeit nicht zu erwarten.“ Herr Meier fährt sich erneut mit der Hand durch sein Haar und schaut auf seine Schuhe, bevor er kaum noch verständlich weiterspricht: „Ich werde mit jedem von ihnen reden. Mitarbeiter mit schulpflichtigen Kindern, die weder umziehen noch auswandern können, müssen sich zunächst keine Sorgen machen. Das Ganze tut mir unendlich leid.“
Ein halbes Jahr später ist die Hälfte der Belegschaft entlassen.
Emma wird im Büro für die Entlassungspapiere und die ausstehenden Löhne noch gebraucht. Es schnürt ihr das Herz zu, den scheidenden Mitarbeitern beim Abschied in die Augen sehen und ihnen die Hand geben zu sollen.
Die neueste Ausgabe ihrer Zeitung macht ebenfalls keinen Mut. Emma hat das Gefühl, je länger schlimme Nachrichten auf sie alle einstürzen, umso fatalistischer wird sie. Das Gefühl der Ohnmacht verstärkt sich: wir können es nicht ändern, können aber auch nicht unbegrenzt täglich neu verzweifelt sein. Die Augen lesen die neuen Nachrichten, aber Herz und Sinne kapseln sich nach und nach ab und schützen sich so vor zu viel Bedrängnis.
Sie liest, dass Im Ruhrgebiet die Bergarbeiter streiken. Die Franzosen, die im Gegenzug zu unvollständigen Kohlelieferungen das Ruhrgebiet besetzen, verursachen durch ihre Anwesenheit eine noch schlechtere Kohleausbeute. Die Bergarbeiter sind nicht mehr bereit, diese Bedingungen hinzunehmen. Die Regierung ist auf ihrer Seite und bereit, die Löhne in Millionenhöhe zu bezahlen, als die Streikkassen leer sind. Als dem deutschen Staat für diesen Streik ebenfalls das Geld ausgeht, lässt er Geld drucken. Je mehr Geld in Umlauf geht, desto wertloser wird es. Die Preise steigen. Auch die Löhne steigen, aber in langsamerem Tempo. Die Kaufkraft sinkt.
Wer Geld hat, kauft Werte wie Häuser, Grundstücke oder Getreide. Wer Ersparnisse hat, erlebt, wie diese von Tag zu Tag dahinschmelzen. Das trifft vor allem kleine und mittlere Handwerksbetriebe. Viele müssen schließen und reihen sich in die stetig größer werdende Gruppe der Arbeitslosen ein, die vor Suppenküchen auf einen Teller Wassersuppe warten.
Emma entscheidet sich zu etwas, das sie noch drei Jahre zuvor nicht einmal im Traum erwogen hätte und was ihr auch jetzt Beklemmungen und Herzklopfen verursacht, hofft aber, das Richtige zu tun. Sie erfüllt sich ihren Kindheitstraum und kauft ein Klavier, ein wunderbares neues, schwarz lackiertes Klavier auf Raten, bevor das ersparte Geld wertlos wird.
Endlich hat sie den Platz dafür in ihrer eigenen, fein renovierten Wohnung. Als es eintrifft, ist sie aufgeregt wie lange nicht. Kaum sind die Träger mit ihren Gurten abgezogen, setzt sie sich an das Instrument, schlägt den Deckel auf, schaut auf die schwarzen und weißen Tasten, atmet den Duft nach Holz und frischem Lack, fährt mit einer Hand behutsam über die Tasten und spürt, wie ihr vor Glück Tränen die Wangen herunterlaufen.
Seit einem knappen Jahr hatte Emma am Konservatorium Musiktheorie belegt. Über Tante Selma, bei der sie als Kind Lautenunterricht erhielt, hatte sie eine alte Klavierlehrerin kennengelernt, die ihr für wenig Geld Klavierunterricht gab. Sie durfte dort üben, nahm dieses Angebot jedoch nur selten in Anspruch, um der alten Dame ihr Geklimper, wie sie es nannte, nicht zuzumuten. Aber Frau Manzel, die Klavierlehrerin, hatte Emma gern bei sich. Sie erkannte schnell, dass sie es mit einem jungen Menschen von außergewöhnlicher Musikalität und Begeisterung für das Erlernen des Klavierspiels zu tun hatte. So war Emma schnell vorangekommen und konnte bereits leidlich spielen, als ihr schwarzglänzendes Klavier in ihrer Wohnung eintraf.
Sie holte Noten, die sie bereits gesammelt hatte und spielte als Willkommensgruß für das Klavier in ihrem kleinen Reich ‚Für Elise‘ von Franz Schubert. Endlich! Endlich ihr Klavier.
Es ließ sie vergessen, dass Winter war, dass sie kalte Hände hatte, dass sie sich in eine Decke einhüllen musste, weil sich ihre Beine wie Eiszapfen anfühlten, dass sie Hunger hatte und auch heute nur eine Steckrübensuppe, auf ihrem ebenfalls neu erworbenen Kanonenofen zubereitet, ihr Abendessen sein würde. Sie konnte vorübergehend das Leid ihrer Kollegen vergessen, die sich mit Tränen im Gesicht von ihr verabschiedet hatten, weil sie nicht bleiben konnten.
Emma konnte von nun an die Welt da draußen mit all ihrem nicht enden wollenden Elend für Stunden ausschalten. Sie schlief weniger und übte lieber. Ihre Freude war so überwältigend, dass sie keine Müdigkeit verspürte. Sie aß noch weniger, um schneller von ihren Ratenverpflichtungen herunterzukommen. Schließlich hatte sie wegen der schwindenden Kaufkraft des Geldes bereits ihre Nähmaschine auf Raten gekauft. Sie hatte beschlossen, für sich nur das Nötigste zu nähen, bis der größte Teil ihrer Schulden abgestottert sein würde. Sie ahnte, dass die böse Inflation ihr helfen würde, bald schuldenfrei zu sein. Dass es dann noch schneller gehen würde als vermutet, hatte sie nicht zu hoffen gewagt.
Die Tageseinnahmen, die sie an jedem Abend in ihrem Büro zusammen mit einer Kollegin zählte, bewegten sich in immer größeren Zahlen. Im Juni 1923, die Geldentwertung war noch nicht auf ihrem Höhepunkt angekommen, ließen ihre Kollegin Thea und sie die sechs Nullen auf den Geldscheinen jeweils weg und zählten nur noch die Zahlen davor. Sie bündelten das Geld und warfen es in einen Waschkorb. Aus diesem Waschkorb verteilten sie im Wochenrhythmus die Löhne in Form solcher Geldscheinbündel in kleinere Körbe, die die Mitarbeiter abholten und noch am selben Tag in ihren Laden trugen, um die Grundnahrungsmittel zu kaufen, die auf Lebensmittelmarken zu haben waren. Geld, das man nicht ausgab, war am nächsten Tag nur noch die Hälfte oder weniger wert. Der Anblick wirkte grotesk: Menschen gingen mit Geldkörben zum Einkaufen und kamen zuweilen mit einem Brot als Gegenwert zurück.
Emma hatte, seit sie eigenes Geld verdiente, ein Wirtschaftsbuch geführt, um verfolgen zu können, wo ihr Geld geblieben war. So konnte sie eines Tages die Preisentwicklung nachvollziehen. Aus ihren Notizen und ihrem Wirtschaftsbuch gingen die folgenden Daten hervor, die sie am Jahresende 1923 anlässlich einer kleinen internen Silvesterfeier mit spendierter Extrascheibe Brot von ihrem Chef und einer heißen Tasse Pfefferminztee ihren Kollegen vorlas:
„1914 betrug der Preis für einen Dollar 4,20 Goldmark. Im Jahr 1923 kostete ein Dollar 4,21 Billionen Goldmark. Gegenwärtig ändert sich der Preis eines Dollars fast stündlich. Im Januar 1923 betrug der Preis für ein Brot 250, im August 69.000, im September 1,5 Millionen, im Dezember 399 Milliarden Goldmark.
Im Juni 1923 kostete ein Ei 800, ein Pfund Kaffee 26.000 – 36.000 Mark, im Dezember 1923 ein Kilo Kartoffeln 90 Milliarden, 1 Ei 320 Milliarden, ein Pfund Butter 2.800 Milliarden, ein Zentner – Briketts 1981 Milliarden Goldmark.“
Die meisten Kollegen schütteln fassungslos den Kopf. Weil diese Preisentwicklung derart aberwitzig ist, können einige mit Galgenhumor darüber lachen in völliger Ohnmacht und dem Gefühl, diesen undurchschaubaren Mechanismen ausgeliefert zu sein, die sich verselbständigt zu haben scheinen.
1924 streiken 140.000