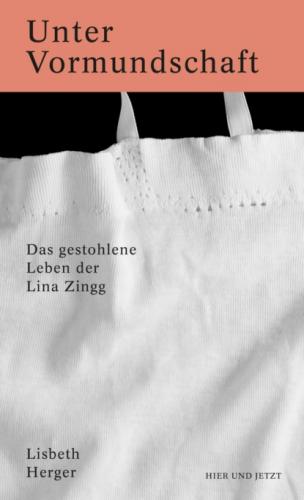Unter Vormundschaft. Lisbeth Herger
diesbezüglich gar nichts. Die Einträge in der Krankenakte und die weitere Entwicklung der Geschichte lassen vermuten, dass die Ärzte an einem Austausch nicht wirklich interessiert sind. «Der Vater, den wir nur flüchtig kennen, dürfte schwachsinnig sein», schreibt Chefarzt Dr. Rauheisen schon früh in die Krankenakte, ohne den Mann je gesehen zu haben. Aber auch Linas rechtlicher Beistand wird in der Frage nicht konsultiert. Als Halbwaise war Lina nach dem Tod ihrer Mutter zusammen mit ihren drei Brüdern automatisch verbeiständet worden. Man hatte damals für das Amt den Hufschmied des Dorfes eingesetzt, Peter Schmetzer, einen Nachbarn der Familie, eine stille Übereinkunft zwischen Behörde und Familie. Die Wiler Ärzte wissen um diesen Beistand, denn auf dem Deckblatt der Akte ist er namentlich vermerkt. Als Ansprechperson aber kommt Peter Schmetzer für sie offenbar nicht infrage, jedenfalls ist nirgends eine entsprechende Notiz greifbar. Vielleicht zweifeln sie – nicht unbegründet, wie sich zeigen wird – an seiner Kompetenz, oder aber sie scheuen seinen Widerstand. Denn die Herren Doktoren in Wil haben ihre eigenen Pläne.
Chefarzt Rauheisen fackelt nicht lange, er will einen radikalen Schnitt und steuert den Entzug der elterlichen Gewalt des Vaters an. Im Wissen, dass die Behörden in dieser Frage aufgrund der geltenden Gesetze leichtes Spiel haben. Einer seiner Kollegen spricht in der heiklen Angelegenheit telefonisch mit Pfarrer Stocker. Dieser schreckt vor solch forschen Plänen allerdings vorerst zurück.
Auf die Mitteilung hin, dass wir Entzug der elterl. Gewalt gegenüber dem Vater in Erwägung gezogen hätten, meint er sogleich, damit möge man unbedingt noch zuwarten, umso mehr als eigentlich das vorliegende Material diese letzte Massnahme kaum zu begründen vermöchte.
Der Arzt aber drängt und bittet den Pfarrer, mit dem unbekannten Vater Tacheles zu reden: «Ich rate dazu, den Vater nun ernstlich vor die Tatsache zu stellen, dass eine Rückkehr des Mädchens zu ihm nach Hause nicht in Frage komme und wir die Patientin nur dann entlassen können, wenn er auf diese Bedingung eintrete. Unsererseits würde dann ein geeigneter leichter Platz bei verständiger Familie gesucht (was allerdings Zeit braucht).» Schliesslich erklärt der Pfarrer sich bereit, mit Bauer Hans die Sache zu besprechen und ihn für eine Aussprache in Wil zu motivieren. «Es wird dann vom Resultat dieser und der vorgängig mit dem Pfarrer stattfindenden Besprechung abhängig gemacht werden müssen, ob vormundschaftliche Massnahmen im Sinne einer Verfügung oder des Entzugs der elt. [elterlichen] Gewalt unumgänglich sind.»
Im Weiteren hofft der verhandelnde Arzt, mithilfe des Pfarrers doch noch fürsorgerische Unterstützung für die Familie einfädeln zu können. «Ich bitte nun den Pfarrer sehr, uns in der Richtung behilflich zu sein, dass er den Leuten hilft, jemanden zu finden, der – wenn nicht beständig – so doch in regelmässigen Zeitabständen den Haushalt in Ordnung bringt (der kath. Frauenbund soll sich da einsetzen).» Pfarrer Stocker erklärt sich auch damit einverstanden und verspricht, die Sache an die Hand zu nehmen. Am Schluss der Besprechungsnotiz wird noch einmal das Versagen des Vaters ins Zentrum gerückt:
Schliesslich stellt sich auch noch heraus, dass auch die andern Kinder vom Vater allzu leicht überfordert werden. Der jüngste Bub sei in seiner geistig-seelischen Entwicklung auffallend im Rückstand. Der Vater – so meint der Pfarrer – sei eben doch weitgehend beschränkt, er meine es ja sonst nicht übel, aber er sei halt auch jähzornig und darunter scheint besonders die Pat. gelitten zu haben.
Werner, Linas ältester Bruder, der später den väterlichen Hof übernehmen wird und heute längst pensioniert ist, liest Akteneinträge wie die zitierten mit einem hilflosen Schulterzucken. Der Vater sei ein roher Mann gewesen, das sei richtig, man habe nicht viel sagen dürfen, und schon habe man eine abgekriegt. Aber dass er schwachsinnig gewesen sei, weist er weit von sich. Und Emma, seine Frau, die als Nachbarmädchen mit den Zingg-Kindern aufgewachsen ist, die Vater Zingg also seit jeher gekannt hat und die später mit ihm als seine Schwiegertochter im selben Haushalt lebt, zeigt sich empört. Er getraute sich halt nie etwas zu sagen, so übersetzt sie die von den Ärzten aufgestellte Ferndiagnose des Schwachsinns. Und vielleicht habe er sich ja auch deshalb nicht um ein Treffen mit den Ärzten bemüht. Lina selbst aber hat vor allem den Zorn ihres Vaters nicht vergessen und seine Schläge. Sie wirft, wenn sie erzählt, zur Illustration eine paar kräftige Ohrfeigen durch die Luft. Und stellt nüchtern fest, das habe so lange fortgedauert, bis sie sich gewehrt und zurückgeschlagen habe. Dann habe sie ihre Ruhe gehabt.
Ob Bauer Zingg wortgewaltig oder vielmehr eher hilflos störrisch um die Heimkehr seiner Tochter kämpft, findet sich nicht in der Krankenakte. Dort steht lediglich ein Hinweis, dass er nach Bekanntgabe der ärztlichen Pläne mehrmals nach Wil reist, um seine Tochter zurückzuholen. Dass er sich tatsächlich querstellt und dass ihm dies zusätzlich angelastet wird, kann man in der dicken Vormundschaftsakte von Lina Zingg genauer nachlesen. Und zwar im allerersten Dokument, dem chefärztlichen Antrag zum Entzug der elterlichen Gewalt Hans Zinggs und zur Bevormundung von dessen Tochter Lina. Der Antrag richtet sich an das Waisenamt der Gemeinde Vorderberg, datiert vom 19. September 1958, und wird, wie erwähnt, von Klinikdirektor Rauheisen verfasst und von Abteilungsarzt Dr. Müller mit unterzeichnet.
Der auf drei Schreibmaschinenseiten ausgelegte Antrag ist in vielen Punkten informativ. Zum einen illustriert er die diagnostische Entwicklung des Falls. Aus der im Aufnahmerapport als rotwangigen und gesund aussehenden jungen Frau, die etwas schmutzig und ungepflegt daherkommt – damals in ländlich armem Milieu nicht eben selten –, ist eine verwahrloste Irre geworden.
Das Mädchen wurde in schwer verwahrlostem Zustand, vor Schmutz starrend, von ihrem Vater zu uns gebracht, der angab, dass sie seit ca. zwei bis drei Jahren geistig nicht mehr normal sei, ohne dass es bisher zu einer Internierung gekommen sei.
In der Anamnese sprach man noch von einem Jahr schleichender Erkrankung, nun sind daraus zwei bis drei geworden. Überdies wird die gestellte Diagnose als gesichert präsentiert, obwohl wichtige Symptome wie Halluzinationen und Wahnvorstellungen fehlen. Die Besserung von Linas Zustand wird als Erfolg der Klinik verbucht:
Es liegt bei Lina Zingg, die zudem noch in leichterem Grade schwachsinnig ist, eine Geisteskrankheit (Schizophrenie) vor. Durch intensive Behandlung konnten wir die geistigen Störungen zwar nicht völlig heilen, jedoch soweit bessern, dass das Mädchen in Kürze wieder ausserhalb der Anstalt gehalten werden könne.
Nachfolgend skizziert der Direktor die Uneinsichtigkeit des Vaters für seinen Plan, die Patientin an eine geeignete Haushaltsstelle zu vermitteln.
Der Vater der Patientin ist mit unseren Vorschlägen nicht einverstanden und verlangt, dass das Mädchen nach Hause komme und ihm und den beiden jüngeren Brüdern den Haushalt führe. Dem Mädchen gegenüber erklärte Herr Zingg ausserdem, dass sie, wenn er wieder geheiratet habe, was in den nächsten Wochen erfolgen soll, wieder in die Fabrik gehen und gleichzeitig der Stiefmutter, die eine grössere Anzahl Kinder mitbringt, im Haushalt helfen könne.
In der anschliessenden Begründung zum geforderten Entzug der elterlichen Gewalt verschiebt Dr. Rauheisen ein klein wenig die Perspektive. Auslöser von Linas Erkrankung ist plötzlich nicht mehr die erbliche Belastung durch die Mutter, sondern vielmehr die frühere Uneinsichtigkeit des Vaters, der «das Mädchen erheblich über seine Kräfte belastet» und der es zudem versäumt habe, sie rechtzeitig «der dringend notwendigen Anstaltsbehandlung zuzuführen». Die nächste Überforderung Linas im Falle einer Heimkehr sei für ihn deshalb nur eine Frage der Zeit, führt der Chefarzt weiter aus, und so bleibe ihm, da der Vater sich – auch nach mehrmaligen Versuchen, ihn umzustimmen – beharrlich gegen eine Fremdplatzierung stemme, als nächster Schritt nur der Entzug der elterlichen Gewalt. «Wir halten es nun für unverantwortlich, Lina Zingg in die gleichen Verhältnisse zurückzuversetzen, wie dies ihr Vater, der, soweit wir dies nach einer kürzeren Unterredung beurteilen können, schwachsinnig zu sein scheint, von uns verlangt und möchten den Antrag stellen, Herrn Zingg die elterliche Gewalt über das Mädchen gemäss Art. 283 ZGB [sic] zu entziehen und einen Vormund für sie zu ernennen.»
Dr. Rauheisen stützt sich in seinem Begehren dann korrekterweise auf Art. 285 des Zivilgesetzbuches (ZGB), auf einen der drei unrühmlich bekannt gewordenen Artikel, die es den Schweizer Behörden seit 1912 erlaubten, Kinder den Eltern zu entziehen und in Heimen oder Privathaushaltungen zu platzieren, wenn das sogenannte Kindswohl gefährdet schien. Die Behörden intervenierten nicht