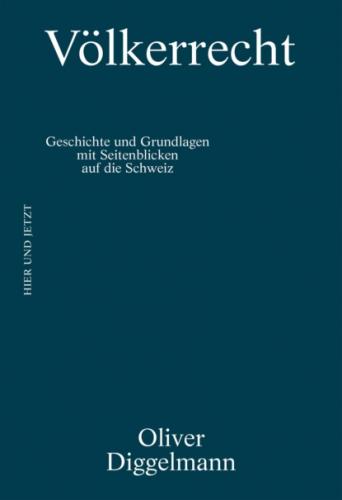Völkerrecht. Oliver Diggelmann
eine strategische Rolle. Eroberungen von fremden Kontinenten wurden nicht situativ, sondern grundsätzlich gerechtfertigt – und vor allem wurden sie rechtlich gerechtfertigt. Eine entscheidende Weichenstellung war, wie der Historiker Jörg Fisch zu Recht herausgehoben hat, in Kategorien von Rechten und Ansprüchen über das Thema zu verhandeln.22 In den meisten Gebieten der Erde kam es zu einer kürzeren oder längeren Kolonialherrschaft. Man bediente sich einer verharmlosenden Sprache, indem Eroberungen in Entdeckungen umgedeutet wurden, und Völkerrechtler diskutierten dann die Frage, wann ein Gebiet als «entdeckt» gelten konnte.
Drei Grundmuster der rechtlichen Rechtfertigung kolonialer Eroberungen lassen sich unterscheiden.23 Das erste war «Expansion als Auftragserfüllung». Es ist im 16. Jahrhundert etwa beim spanischen Theologen Francisco Suarez (1548–1617) zu finden. Suarez behauptete, dass Gott den spanischen Kolonisatoren Vollmacht zur Verkündung des Evangeliums erteilt habe und dass dies die Zulässigkeit von Eroberungen voraussetze. Die Auftragsidee sollte später, insbesondere im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in Gestalt der Idee der «civilizing mission», noch einmal eine zentrale Rolle spielen.24 Sie blieb bis in die Völkerbundzeit lebendig, als man bei den auf die Unabhängigkeit vorzubereitenden Völkern verschiedene Entwicklungsgrade unterschied, A-, B- und C-Mandate; die Mandatsmacht – der Beauftragte – sollte das Kolonialvolk an den für die Völkerrechtsfähigkeit erforderlichen Entwicklungsstand heranführen.
Das zweite Rechtfertigungsschema war «Expansion als Verteidigung der natürlichen Ordnung». Es ist im 16. Jahrhundert beim bereits erwähnten Francisco de Vitoria (1483–1546) zu finden. Wer die Verkündung des Evangeliums verhindere, argumentierte er, schaffe einen legitimen Kriegsgrund, genauso wie der, der das Recht auf Handel und Niederlassung verweigere. Das dritte Muster schliesslich war das «Nichtwahrnehmen» von Nichtchristen. Es ist das arroganteste und wirksamste der drei. Viele Anhänger des päpstlichen Universalismus argumentierten, Ungläubige seien prinzipiell nicht rechts- und schon gar nicht eigentumsfähig. Sie begingen wegen ihres falschen Glaubens eine Todsünde gegen Gott und würden dadurch Rechts- und Eigentumsfähigkeit verwirken. Später spielte das Schema bei der rechtlichen Einordnung von Indianerstämmen eine Rolle. Man schloss mit ihnen zwar zivilrechtliche Verträge, kaufte ihnen Handelsgüter und Boden ab, betrachtete ihre Gebiete völkerrechtlich aber als unbewohnte Territorien. Dafür verwendete man teilweise die aus dem römischen Recht geliehene Formel «terra nullius»: das Gebiet, das niemandem gehört.25 Die Eroberung eines von Indianern bewohnten Gebiets war deshalb keine Annexion, sondern blosse Okkupation. Bei der rechtlichen Begründung der gut 500 Jahre dauernden Kolonialisierung der Welt durch die Europäer gab es eine bemerkenswerte Kontinuität der Argumente.
Seitenblick: Alte Eidgenossenschaft
Das Herauswachsen der Alten Eidgenossenschaft aus mittelalterlichen Strukturen war Teil der Entstehung des modernen Staatensystems. Sie blieb bis zum Dreissigjährigen Krieg ein Bündnissystem innerhalb des Heiligen Römischen Reichs, ab dem 15. und insbesondere 16. Jahrhundert mit verstärkter relativer Autonomie der reichsunmittelbaren, das heisst direkt dem Kaiser unterstellten alteidgenössischen Orte. Die Konfessionsspaltung hatte auch hier bedeutende Folgen. Zum einen ergaben sich bis ins 18. und 19. Jahrhundert heftige Konflikte zwischen den Konfessionen, die teilweise mittels Kriegen ausgetragen wurden. Erwähnt sei etwa der Erste Villmergerkrieg von 1656, in dem die protestantischen Orte vergeblich versuchten, die starke Stellung der Katholiken zu schwächen. Zum anderen büsste die Alte Eidgenossenschaft ihre aussenpolitische Handlungsfähigkeit unter dem Vorzeichen der Bikonfessionalität zu einem grossen Teil ein. Sie war wegen ihrer eigenen Gespaltenheit gezwungen, sich aus Streitigkeiten anderer tendenziell herauszuhalten. Als souverän anerkannt wurden die Alten Orte am Ende des Dreissigjährigen Kriegs. Sie schieden damals aus dem Reich aus.26 Wer aber war nun souverän – die dreizehn Alten Orte für sich oder das Bündnissystem? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Der Friede von Osnabrück von 1648 nannte zwar die «Kantone der Schweiz» als Parteien, aussenpolitisch handelten die Kantone aber nicht jeder für sich. Seit dem Eintritt Basels in das eidgenössische Bündnissystem 1501 galt vielmehr die Regel, dass äussere Kriege nicht ohne Zustimmung der Tagsatzungsmehrheit geführt werden durften. Zudem verlangten die Mächtigen verschiedentlich, etwa Ludwig XIV. und später Napoleon, dass die Eidgenossen mit einer Stimme sprechen sollten. Die Frage der Souveränität blieb in der Schwebe.
Folgenreich war für die Eidgenossenschaft auf lange Sicht, dass Säkularisierung und Gleichgewichtsdenken in Europa ihre Möglichkeiten verbesserte, sich aus den Konflikten herauszuhalten. Anders als bei einem Denken in den religiösen Kategorien «gut» und «böse», konnte Unparteilichkeit unter den Vorzeichen säkularen Denkens bei Interessengegensätzen eine Pufferfunktion für das Gesamtsystem übernehmen. Stiess eine unparteiliche Haltung während des Dreissigjährigen Kriegs noch auf grosse Skepsis, wurde es nach dem Ende des Dreissigjährigen Kriegs für Nichtkriegführende einfacher, ihre Stellung durch Abmachungen mit den Konfliktparteien abzusichern. 1674 erklärte sich die Tagsatzung erstmals offiziell für neutral, wobei Neutralität noch kein rechtliches und auf Dauer angelegtes Konzept war. Viele Staaten erklärten sich in der frühen Neuzeit punktuell für neutral. Es handelte sich keineswegs nur um kleinere Staaten, sondern durchaus auch um Grossmächte wie etwa Preussen. Zu einem dauerhaften Element der Positionierung im Staatensystem wurde Neutralität allerdings nur bei ganz wenigen, und ein eigentliches Neutralitätsrecht aus einem Bündel von Rechten und Pflichten entwickelte sich erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts.27 Der aus Neuenburg stammende Emer de Vattel (1714–1767), zeitweise in kursächsischen Diensten, hatte an der Verrechtlichung grossen Anteil. Neutralität war in seiner naturrechtlichen Völkerrechtslehre bereits ein Rechtsstatus, der auf einseitige Erklärung des Betroffenen hin zustande kommt. Ab etwa 1780 kann man von einem rechtlich grundierten Neutralitätsstatus sprechen. In diesem Jahr hatten verschiedene bedeutende Staaten – darunter Russland, Preussen und Frankreich – erklärt, im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg neutral zu bleiben und diese Neutralität gegebenenfalls bewaffnet zu verteidigen.
19. Jahrhundert und Erster Weltkrieg
Vielfältige Formen imperialer Beherrschung: Wettstreit der Grossmächte um Einfluss in China.
Stabilisierung durch Völkerrecht
Die Französische Revolution und die Machtergreifung durch Napoleon führten zu einer mehr als zwanzig Jahre dauernden Periode von Kriegen in Europa. In den Auseinandersetzungen, die als «Koalitionskriege» bezeichnet werden, kämpften verschiedene Allianzen gegen das revolutionäre und später napoleonische Frankreich.28 Nach Frankreichs Niederlage kam es in Wien, wie nach dem Dreissigjährigen Krieg in Westfalen, zu einer Staatenkonferenz. Sie legte die Grundparameter der internationalen Ordnung neu fest. Der Wiener Kongress schuf eine Ordnung, die – nach überwiegender Meinung – in den Grundzügen bis zum Ersten Weltkrieg Bestand hatte und angesichts der gewaltigen ökonomischen und sozialen Veränderungen während dieses Jahrhunderts von bemerkenswerter Dauer war.29
Die neue Ordnung beruhte im Wesentlichen auf drei Elementen: der Rückkehr zum dynastischen Prinzip, bald in Anlehnung an eine Formulierung des Schweizer Staatsrechtlers Karl Ludwig von Haller als «Restauration» bezeichnet; moderner Diplomatie auf der Grundlage des Gleichgewichts der Mächte; schliesslich einer bedeutenderen Rolle des Völkerrechts. Dem Völkerrecht war in der post-napoleonischen Friedensordnung eine wichtigere Rolle zugedacht als in der Ära nach dem Westfälischen Frieden. Man setzte darauf, die internationalen Beziehungen durch Verträge zu stabilisieren. Beispiel ist etwa der Londoner Vertrag von 1839. Die Grossmächte garantierten – im Interesse europäischer Stabilität – die Neutralität Belgiens. Jener Neutralität bemerkenswerterweise, deren Bruch 75 Jahre später durch den Angriff Deutschlands auf Belgien den Beginn des Ersten Weltkriegs markieren sollte.
Merkmal der Ordnung nach 1815 war auch eine stärker hervorgehobene Stellung der Führungsmächte. Grossbritannien, Russland, Österreich, Preussen und bald auch wieder Frankreich übernahmen