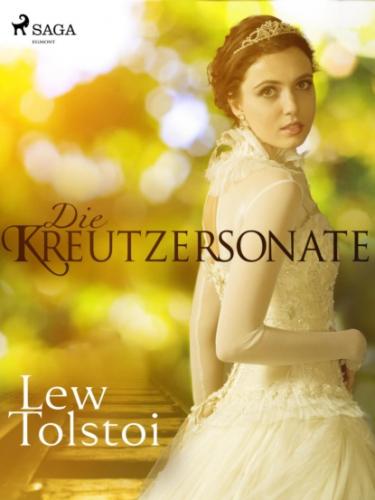Die Kreutzersonate. Лев Толстой
abschweifen von der Frage der Bevorzugung eines oder einer vor anderen. Ich möchte ja eben wissen, wie lange eine solche Bevorzugung anhalten soll?“
„Wie lange? Sehr lange, oft zeitlebens“, antwortete achselzuckend die Dame.
„Im Roman — ja — nie aber im Leben. Im Leben hält diese Bevorzugung höchstens einige Jahre, öfter einige Monate, meist aber doch nur Wochen, Tage oder Stunden an“, sagte er. Man fühlte, daß er uns mit dieser Ansicht verblüffen wollte, und er war auch sichtbar zufrieden darüber.
„Aber erlauben Sie! Nein, nicht doch!“ riefen wir alle drei plötzlich auf einmal. Selbst der Handlungsgehilfe stieß irgendeinen Laut von sich.
„Ich, ja, ja, ich weiß es!“ überschrie uns alle der grauhaarige Herr. „Sie alle sprechen von dem, was als feststehend gilt, ich aber von dem, was feststeht. Jeder Mann empfindet das, was Sie mit Liebe bezeichnen, für jede hübsche Frau.“
„Nein, das ist ja schrecklich, was Sie da sagen! Es wohnt doch im Menschen ein Gefühl, das man Liebe nennt, und das nicht Monate und Jahre — sondern die ganze Lebensdauer beherrscht.“
„Nein, das stimmt nicht! Zugegeben, daß ein Mann für die ganze Zeit seines Lebens eine bestimmte Frau allen andern vorzieht, so ist doch mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß diese Frau einem anderen den Vorzug geben wird. Von jeher war das so und wird auch immer so bleiben“, bekräftigte er, nahm eine Zigarette aus seinem Etui und begann zu rauchen.
„Das Gefühl kann doch aber auch von beiden Seiten ein gleiches sein“, bemerkte der Anwalt.
„Nein, das kann es nicht sein,“ erwiderte jener, „das ist ebenso undenkbar wie die Möglichkeit, daß in einem Wagen voller Erbsen zwei vorher bezeichnete Erbsen nebeneinander zu liegen kämen. Auch daher wäre das schon gänzlich unmöglich, weil dann unbedingt eine Übersättigung sich einstellen würde. Von einem Manne oder einer Frau verlangen, das ganze Leben hindurch einen einzigen Menschen zu lieben, ist gleichbedeutend, von einer Kerze zu erwarten, ein ganzes Leben hindurch brennen zu können.
„Sie sprechen ja doch aber immer nur von der sinnlichen Liebe. Erkennen Sie denn keine Liebe an, die auf Gleichheit der Ideale, auf Wahlverwandtschaft fundamentiert ist?“ entgegnete die Dame.
„Wahlverwandtschaft, Gleichheit der Ideale!“ wiederholte er, einen seltsamen Laut von sich gebend. „Aus welchem Grunde soll man denn aber dann, verzeihen Sie den vulgären Ausdruck, zusammen schlafen? Legen sich die Menschen vielleicht aus Gleichheit der Ideale zusammen ins Bett?“ fragte er nervös lächelnd.
„Halt! Erlauben Sie,“ bat der Anwalt, „die Tatsachen widersprechen dem, was Sie sagen. Jeder weiß doch, daß Ehen bestehen, daß die Menschheit, oder doch zum mindesten ein Teil dieser, im Eheverhältnis lebt und daß auch sehr viele ehrlich zeitlebens miteinander verheiratet leben.“
Der nervöse Herr lachte von neuem auf.
„Sie sind der Ansicht, die Ehe sei auf Liebe aufgebaut; wenn ich aber meine Bedenken an der Existenz einer anderen als der sinnlichen Liebe ausspreche, so wollen Sie mir die Existenz der Liebe durch die Existenz der Ehe beweisen. In heutiger Zeit aber ist das ganze Eheleben doch weiter nichts als Lug und Trug.“
„Bitte, erlauben Sie,“ sagte der Anwalt, „ich spreche ja doch nur von der Tatsache, daß es Ehen gibt.“
„Gibt! Gut, warum aber? Sie bestanden und bestehen noch heute bei den Menschen, die in der Ehe ein Sakrament erblicken; ein Sakrament, das den Menschen eine Pflicht Gott gegenüber auferlegt. Solche Menschen besitzen allerdings eine Ehe. Wir andern aber heiraten und betrachten die Ehe einzig und allein nur als Paarungsfaktor. Das, was daraus entsteht, ist ja doch nur Betrug oder Vergewaltigung. Bleibt es nur beim Betrug, dann läßt es sich noch ertragen. Mann und Frau betrügen ihre Mitmenschen, daß sie vortäuschen, in Monogamie zu leben, während sie in Polygamie oder Polyandrie dahinvegetieren. Übel ist das, aber es ist ertragbar. Wenn aber, wie dies das Vorherrschende ist, Mann und Frau, die die gesetzliche Verpflichtung auf sich genommen haben, ihr ganzes Dasein gemeinsam zu durchleben, sich schon im zweiten Ehemonat einander hassen und das Verlangen haben, wieder voneinander zu gehen, dennoch aber weiter nebeneinander herleben, so entsteht daraus jene unerträgliche Hölle, die einen zum Trunk, Selbstmord oder Verbrechen treibt.“
Er hatte sich selbst so in Erregung geredet, daß sich seine Worte überstürzten und keiner auch nur ein Wort dazwischenwerfen konnte.
Es trat eine peinliche Stille ein.
„Gewiß gibt es im Eheleben kritische Episoden“, sagte der Anwalt. Ihm lag viel daran, dieses indiskrete Gespräch, das so hitzige Formen angenommen hatte, endlich abzubrechen.
„Ich habe das Gefühl, Sie haben mich erkannt“, sagte der nervöse Herr leise und ruhig.
„Nein, ich habe nicht das Vergnügen.“
„Ein Vergnügen ist es wohl nicht. Posdnyschow ist mein Name. Ich bin die Person mit der kritischen Episode, auf die sie soeben angespielt haben, der Episode, in der der Mann seine Frau ermordet hat“, sagte er, während er uns alle mit einem pfeilschnellen Blick streifte.
Keiner von uns konnte etwas darauf erwidern.
„Übrigens ist es ja ganz belanglos“, meinte er und stieß wieder seinen eigentümlichen Ton aus. „Verzeihen Sie übrigens! Ich möchte mich Ihnen nicht weiter aufdrängen.“
„Aber nein, bitte sehr . . .“ erwiderte der Anwalt, ohne recht zu wissen, was das ,bitte‘ eigentlich bezeichnen sollte. Posdnyschow achtete aber nicht darauf, wandte sich um und nahm wieder seinen alten Platz ein. Der Herr und die Dame tuschelten miteinander. Ich saß neben Posdnyschow und schwieg. Ich wußte nichts zu reden. Da es zum Lesen zu dunkel war, schloß ich die Augen und tat, als ob ich schlafen wollte. Schweigend fuhren wir so bis zur nächsten Station. Hier stiegen der Herr und die Dame, wie sie dies bereits vorher mit dem Schaffner besprochen hatten, in ein anderes Abteil. Der Handlungsgehilfe streckte sich lang auf der Bank aus und schlief ein. Posdnyschow rauchte weiter und trank seinen Tee, den er sich noch auf der letzten Station zubereitet hatte. Als ich die Augen öffnete und zu ihm hinblickte, wandte er sich plötzlich energisch und stark erregt an mich:
„Sollte es Ihnen vielleicht unheimlich sein, mit mir zusammenzusitzen, jetzt, wo Sie wissen, wen Sie vor sich haben, so kann ich ja hinausgehen?“
„Aber wieso! Durchaus nicht!“
„Darf ich Ihnen vielleicht einen Tee anbieten? Er ist zwar etwas stark.“
Er füllte ein Glas für mich.
„Alles das Gerede! Alles Lug und Trug . . .“ sagte er.
„Von was sprechen Sie, bitte?“ fragte ich ihn.
„Noch immer vom gleichen Thema. Was die mit Liebe bezeichnen. Wollen Sie nicht schlafen?“
„Nein, noch nicht!“
„Interessiert es Sie, zu hören, wie mich diese gleiche Liebe zu dem Ereignis getrieben hat, das ich erlebt habe?“
„Wenn es Ihnen nicht zu schwer wird?“
„Nein, aber das Schweigen fällt mir schwer, Trinken Sie doch den Tee. Oder ist er Ihnen zu stark?“
Er war wirklich wie Bier so dunkel, aber dennoch trank ich mein Glas aus. In diesem Augenblick ging der Schaffner durch den Wagen. Posdnyschow verfolgte ihn mit grimmigen Blicken, und erst als er fort war, nahm er die Erzählung auf.
3.
„Also ich werde Ihnen erzählen . . . Interessiert es Sie aber auch wirklich?“
Noch einmal beteuerte ich ihm, daß es mich sehr interessiere. Er dachte nach, fuhr mit der Hand über seine Stirn und begann:
„Ich muß meine Erzählung von Anfang an beginnen. Da muß ich Ihnen zuerst sagen, wie und warum ich geheiratet habe und was für ein Leben ich vor meiner Heirat geführt hatte.
Vor meiner Heirat lebte ich wie alle unseres Standes.