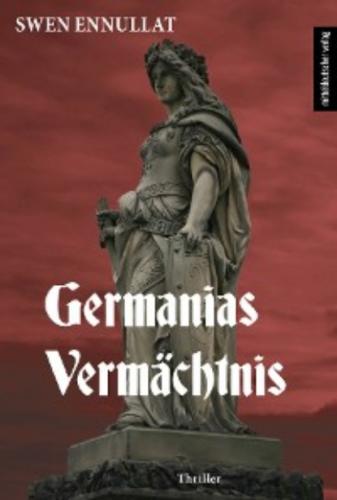Germanias Vermächtnis. Swen Ennullat
Geschichte, wenn alle Medien bereits darüber berichtet haben?“
Sein Nachbohren war erfolgreich, denn Semmler nickte geheimnisvoll und sagte: „Dass der Schatz wieder auftauchte, war eine Sensation, gewiss. Das Ungewöhnliche ist jedoch, dass gerade zwei Gegenstände verschwunden blieben, von denen ich glaube, dass sie eine besondere Bedeutung haben müssen.“
„Ich versteh nicht recht, was Sie uns damit sagen wollen?“ Professor Meinert war skeptisch.
Ihr Führer jedoch blieb rätselhaft und erwiderte: „Ich kenne jemanden, dem es eher zusteht, diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Zwar könnte ich es auch, weil ich sie schon etliche Male gehört habe, noch kann sie es aber selbst.“
„Sie?“, fragte Julia.
„Ja, meine Tante. Ihr Name ist Frieda Kern. Ich kann Sie miteinander bekannt machen, wenn Sie möchten. Allerdings“, Semmler blickte reihum, „sollten wir Ihre Gruppe wohl etwas verkleinern. Ich will nicht, dass sie sich zu sehr aufregt.“
X
Wie die gekreuzten blauen Schwerter belegten, war die Teetasse aus echtem Meissener Porzellan und Torben stellte sie vorsichtig – darauf bedacht, sie nicht zu zerbrechen – neben seinem aufgeschlagenen Notizbuch ab.
Obwohl er schwarzen Tee nicht mochte, hatte er es nicht übers Herz gebracht, das Angebot der alten Dame, die ihm und dem Professor gegenüber saß, auszuschlagen. Während sie Milch bevorzugte, hatte Torben das heiße Getränk mit viel Zucker für sich genießbar gemacht.
Natürlich hatten sie Semmlers Angebot sofort angenommen, seine Tante und offensichtliche Zeitzeugin der Kriegsjahre kennenzulernen. Spätestens als er erfahren hatte, dass Mathildes Quedlinburg im Zweiten Weltkrieg auch nichts anderes als ein riesiges Krankenhaus gewesen war, wusste Torben, dass die Priesterinnen die Stadt – wie Bad Mergentheim – ebenfalls dazu genutzt hatten, um erneut in einer Menge medizinischen Personals unterzutauchen. Schließlich musste es ihr innerer Antrieb gewesen sein, das Wissen anzuwenden, das sie über Jahrhunderte über das Heilen von Krankheiten und Verletzungen gesammelt und von Generation zu Generation weitergegeben hatten.
Schon der Hinweis der sterbenden Margot hatte in ihm den Verdacht aufkommen lassen, dass das Geheimnis, dem sie nachspürten, auch mit den letzten Kriegstagen in Verbindung stehen könnte. Insoweit gab es nichts Besseres, als mit jemandem zu sprechen, der diese Zeit noch selbst hautnah erlebt hatte. Semmlers Hinweis aufnehmend, hatte Torben vorgeschlagen, lediglich gemeinsam mit dem Professor dessen Tante aufzusuchen. Auch wenn zumindest Levitt sie augenscheinlich gerne begleitet hätte, kam von niemandem Widerspruch. Offenbar hatten beide in ihrer Gruppe noch immer so etwas wie ein Exklusivrecht, einen Bonus, weil sie es waren, die vor einigen Monaten zuerst die Tore zur Geschichte weit aufgestoßen hatten.
Frieda Kern erwies sich als zähe, kleingewachsene Frau, deren Lederhaut verriet, dass sie ihr ganzes Leben im Freien verbracht hatte. Das Fehlen jeglicher Fettpolster und ihr sehniger Körperbau zeigten, dass dieses Leben vermutlich mit harter körperlicher Arbeit verbunden gewesen war.
Nun lebte sie am Rande Quedlinburgs allein in einer kleinen Zweiraumwohnung, welche die Masse der Andenken an die verschiedenen Stationen ihres Lebens kaum fassen konnte. Umrahmt von Fotografien, kleinen Schnitzereien, Figuren, Muscheln und einer Vielzahl anderer billiger Souvenirs stand dabei die Schwarzweißaufnahme eines Mannes im reiferen Alter quasi im Zentrum der Erinnerungsstücke. Frieda Kern hatte ihnen bereits erzählt, dass es sich dabei um ein Foto ihres vor einigen Jahren verstorbenen Ehemannes handelte. Sie erklärte ihnen auch ihr genaues Verwandtschaftsverhältnis zu Semmler, dem Fremdenführer und Neffen der alten Dame, der sie einander vorgestellt hatte, jetzt aber wieder anderen Geschäften nachging.
Torben hörte an dieser Stelle möglicherweise nicht mit der gebotenen Aufmerksamkeit zu, beobachtete aber umso genauer.
Er schätzte Frieda Kerns Alter auf circa achtzig Jahre, ihre verkrümmten Finger schienen ein sicheres Anzeichen von Arthrose und mit der getrübten Linse des rechten Auges sah sie sicherlich nicht mehr viel. Dennoch wirkte sie agil und besaß noch immer einen wachen Verstand. Schon allein aufgrund ihres Alters erinnerte sie ihn an seine Großmutter. Er mochte sie auf Anhieb, fühlte sich auf der eigentlich viel zu weichen Couch inmitten ihres Plunders ausgesprochen wohl und war gespannt, was sie zu berichten hatte. „Sie wollen also etwas über den Domschatz und sein Verschwinden hören“, begann Frieda Kern kurz darauf.
„Das Verschwinden, das Wiederauftauchen, alles was nicht in irgendwelchen Zeitungen stand.“ Torbens offenes Lachen war ehrlich gemeint und öffnete das Herz der alten Dame. Sie seufzte. Mit Blick auf das Foto ihres verstorbenen Mannes begann sie zu erzählen.
„Mein lieber Willi, Gott hab ihn selig, war ein ausgesprochen treuer und liebevoller Mann. Aber manchmal“, sie lächelte verschmitzt, „mögen Frauen eben auch das blanke Gegenteil. Schroffheit und Desinteresse können auch sehr anziehend sein.
Zum Kriegsende im Frühjahr 1945 war ich gerade einmal dreizehn Jahre alt und unsterblich in einen zwei Jahre älteren Jungen verliebt, der natürlich nichts von seinem Glück wusste. Natürlich war Krieg, aber wir waren auch Kinder. Wir sprühten vor Energie und Lebensfreude trotz all dem Leid um uns herum.
Ich versuchte natürlich, die Aufmerksamkeit des Jungen zu erregen. Aber was ich auch machte, nichts wollte klappen. Rückblickend ist das auch nicht verwunderlich, denn meine Mutter verhalf mir jeden Morgen zu schrecklich bieder aussehenden Zöpfen, und von weiblichen Rundungen war bei mir noch nichts zu sehen. Vermutlich sah ich eher wie eine Elfjährige aus, ein Umstand, der wenig später bei der Vielzahl stationierter amerikanischer und danach russischer Soldaten gar nicht schlecht war. Als junges Mädchen nicht aufzufallen, war damals eindeutig ein großer Vorteil, denn es gab immer wieder Fälle, wo sich die ausgehungerten Männer gewaltsam nahmen, was sie begehrten.
Kurzum, es gab also diesen Jungen. Sein Name war Carl, und ich suchte auf plumpe Art und Weise ständig seine Nähe. Wenn er mit seinen Freunden auf der Straße Fußball spielte, schaute ich – natürlich betont desinteressiert – zu. Wenn er mit seinen Eltern sonntags in der Kirche war, drängte ich in seine Richtung. Jeden Abend vor dem Schlafengehen galten meine letzten Gedanken ihm und unserer gemeinsamen Zukunft. Alles andere war mir egal.
Carl besaß ein gewisses zeichnerisches Talent. Es kam dabei schon einmal vor, dass er jemanden für einen Groschen mittels Bleistift porträtierte. Obwohl ich wochenlang ein solches Geldstück bei mir trug, habe ich ihn natürlich nicht gefragt, ob er mich auch einmal malen könnte. Zu groß war meine Angst, dass er mich auslachen oder abweisen würde.
Plötzlich erreichte der Krieg aber auch unsere Stadt und das Leben änderte sich über Nacht. Die Amerikaner rückten ein, durchsuchten jedes Haus, jeden Schuppen, jede Scheune und jeden Keller. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Gesichter der beiden Soldaten, die das Haus meiner Eltern kontrolliert haben, noch immer vor mir, solche Angst hatten wir damals, dass sie uns ausrauben und erschlagen würden. Im Großen und Ganzen verhielten sie sich aber den Umständen entsprechend höflich, wohl auch, weil meine Mutter ihnen ein paar Gläser eingemachtes Obst schenkte.
Wer den Alliierten allerdings suspekt vorkam, allen voran Männer im wehrfähigen Alter, in denen man Wehrmachtssoldaten oder SS-Angehörige vermutete, wurde in Gewahrsam genommen und verhört. So erging es dann auch dem Ehemann von Carls Schwester, der eigentlich nur wegen einer in Russland erlittenen Handverletzung nicht mehr an die Front zurückkehren musste. Er wurde sofort in das Gemeindehaus gebracht, das kurzerhand zum Gefängnis umfunktioniert worden war.
Carl suchte natürlich einen Weg, seinen Schwager zu befreien und trieb sich deshalb in der Nähe der GIs herum. Er muss sehr schnell bemerkt haben, dass einige höherrangige Soldaten im Besitz von sogenannten Entlassungsscheinen waren, in denen lediglich der Name der freizulassenden Person eingetragen werden musste. Um an ein solches Dokument zu gelangen, wählte er sich auf dem Marktplatz einen jungen Offizier mit weichen Gesichtszügen aus, und über sein zeichnerisches Talent – er bot ihm an, ihn zu porträtieren – konnte er mit ihm in Kontakt treten.“
„Ich vermute, das war Joe Thomas Meador, nicht wahr,