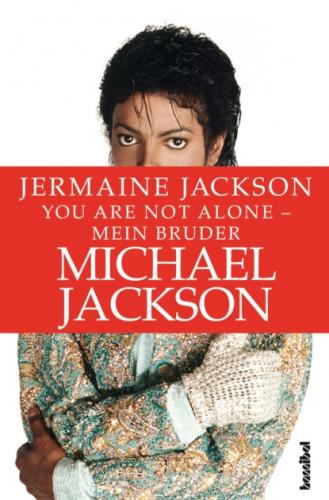You are not alone - Mein Bruder Michael Jackson. Jermaine Jackson
Hit, der Mutter sehr bewegte, denn ihre Wurzeln lagen in Eufaula, Alabama, wo sie im Mai 1930 als Katie Scruse zur Welt gekommen war.
Ihre Großeltern hatten damals im so genannten Baumwollstaat eine Baumwollfarm besessen; ihr Urgroßvater war Sklave der dort lebenden Familie Scruse gewesen. Auch ihre Vorfahren konnten singen: „Seine Stimme schallte aus der Kirche über das ganze Tal“, sagte Mutter von ihrem Großvater, und das Gleiche traf auf Papa Prince zu, ihren Vater. Mutter schwor, dass ihre Stimme, die wir in unserer Küche vernahmen, ein Erbe ihrer Vorfahren darstellte, das sie in einem Kirchenchor weiter ausgebildet hatte. Sie stammte aus einer Baptistenfamilie, und gute Stimmen hatte es dort schon immer gegeben. Der Vater meines Vaters, Samuel Jackson, war Lehrer und Schuldirektor, der eine notenreine Version von „Swing Low, Sweet Chariot“ vortragen konnte, aber im Kirchenchor auch durch eine „herrlich hohe Stimme“ auffiel. Unsere Mutter spielte während ihrer Schulzeit Klarinette und Klavier, Joseph Gitarre.
Als unsere Eltern sich 1949 kennenlernten, vereinte sich ihr jeweiliges Erbgut offenbar zu einer Art Super-Gen, was unsere musikalische Begabung betraf. Das war kein Zufall, wie unsere Mutter immer wieder betonte, es war die Gabe Gottes. Oder, wie Michael es später formulierte, „die göttliche Vereinigung von Musik und Tanz“.
Wir alle liebten den Klang von Mutters Stimme. Wenn sie an der Spüle stand, dann verlor sie sich in den Baumwollfeldern von Alabama, und mir liefen Schauer über den Rücken, wenn ich diese klangvolle Stimme hörte, die nie einen falschen Ton sang. Ob sie sprach oder sang, sie klang stets warm, weich und beruhigend. Wir fingen mit dem Singen an, um ein wenig Unterhaltung zu haben, als unser Fernseher zur Reparatur war, und eines Tages versuchte ich mich an ein paar Harmonien. Ich war etwa fünf Jahre alt, aber ich sang frei die zweite (hohe) Stimme, und das mit völlig reinem Ton. Mutter sah zu mir hinunter, sang weiter, aber lächelte mich ganz überrascht an. Und fast sofort fielen meine Brüder Tito und Jackie und meine Schwester Rebbie mit ein. Michael war noch ein Baby, trug Windeln und lernte gerade erst laufen, aber wenn das Geschirr wieder ordentlich weggestellt und alles fleckenlos sauber poliert worden war, setzte sich Mutter hin, nahm ihn auf den Arm und sang ihn in den Schlaf. „Cotton Fields“ war meine erste Gesangserfahrung und Michaels Schlaflied.
Meine erste Erinnerung an Michael stammt aus dieser Zeit. An seine Geburt oder daran, wie Mutter mit ihm nach Hause kam, erinnere ich mich nicht. Geburten waren in unserer Familie kein großes Ereignis. Ich war fünf, als ich Michael zum ersten Mal wickelte. Ich tat das, was wir alle taten – wir halfen Mutter, wo wir konnten, indem wir in unserer Familie, die später neun Kinder zählte, überall mit Hand anlegten.
Michael war von Geburt an ein Energiebündel voll ungezähmter Neugier. Wenn man ihn auch nur für eine Sekunde aus den Augen ließ, war er unter den Tisch oder unters Bett gekrabbelt. Wenn Mutter unser äußerst schlichtes Waschmaschinenmodell in Betrieb nahm, dann stand er davor und hüpfte im Einklang mit den rumpelnden Vibrationen auf der Stelle hin und her. Ihm auf dem Sofa die volle Windel zu wechseln, glich in etwa dem Versuch, einen nassen Fisch festzuhalten, der sich wand, zuckte und sich hin- und herdrehte. Eine Windel mit Sicherheitsnadeln ordentlich festzustecken war schon für einen Erwachsenen nicht einfach, und für mich als Fünfjährigen bedeutete es eine echte Herausforderung. Glücklicherweise sprangen Rebbie oder Jackie mir oft zur Seite. Michael hatte außergewöhnlich lange, dünne Finger, die meinen Daumen packten, und große Rehaugen, in denen zu lesen stand: „Es macht mir einen Riesenspaß, dir die Sache ein bisschen schwerzumachen, Kumpel.“ In meinen Augen war er aber vor allem der kleine Bruder, auf den man aufpassen musste. Uns allen war immer wieder eingeimpft worden, uns umeinander zu kümmern, aber für Michael fühlte ich mich vom ersten Tag an besonders verantwortlich. Vielleicht lag es daran, dass ich immer nur hörte, wie meine Mutter rief: „Wo ist Michael?“ – „Ist Michael nichts passiert?“ – „Hat jemand Michael gewickelt?“
„Ja, Mutter … Wir haben alles im Griff … er ist hier“, antwortete dann einer von uns.
Keine Sorge. Michael ist nichts passiert. Michael geht es gut.
Unsere Großmutter mütterlicherseits, Mama Martha, badete uns, als wir noch klein waren, in einer breiten Aluminiumschüssel voller Seifenwasser. Später sah ich dabei zu, wie Michael mit hochgereckten Armen und verkniffenem Gesicht in dieser kleinen „Badewanne“ stand und mit enormer Gründlichkeit von den Zehenzwischenräumen bis zu den Ohren ordentlich abgeseift wurde. Wir mussten immer sauber sein und uns vor Keimen in Acht nehmen. Ich glaube, das wurde uns eingebläut, noch bevor wir laufen oder sprechen konnten. Und für echte Sauberkeit ging nichts über Castile-Seife mit ihrem groben Schaum. Einseifen und richtig schrubben. Mutter war sehr genau, wenn es um Sauberkeit ging – für sie musste immer alles ordentlich gewischt und gewienert sein. Sauber allein reichte nicht. Das Haus – und wir natürlich auch – hatte porentief rein zu sein und auch so auszusehen.
Keime wurden als unsichtbare Ungeheuer dargestellt. Von Keimen wurde man krank, hörten wir. Andere Menschen übertrugen Keime. Keime waren in der Luft, auf der Straße, auf allen Oberflächen. Ständig wurde uns das Gefühl vermittelt, wir seien von einer unsichtbaren Invasion bedroht. Wenn einer von uns nieste oder hustete, kam das Rizinusöl auf den Tisch, und jeder von uns bekam einen Löffel, um die Infektion gleich zurückzudrängen. Ich weiß, dass ich hier auch für Michael, La Toya und Janet spreche, wenn ich sage, dass wir mit einer beinahe neurotischen Angst vor Keimen aufwuchsen, und es war nicht schwer zu erraten, weshalb.
Bevor es beim Abwasch mit dem Singen losging, bekamen wir unsere erste wichtige Lektion: „Wir waschen nur mit sauberem Wasser ab … mit SAUBEREM Wasser!“ Lektion Nummer zwei: „Macht das Wasser so heiß, dass ihr es gerade noch aushaltet, und nehmt ordentlich Seifenlauge.“ Jeder Teller wurde geschrubbt, bis die oberste Keramikschicht ganz dünn war. Jedes Glas wurde gespült und abgetrocknet und dann gegen das Licht gehalten, um zu überprüfen, ob sich nicht noch Wasserflecken fanden. Wenn ja, dann musste man noch einmal von vorn anfangen.
Wenn wir von draußen ins Haus kamen, wurden wir zunächst einmal entseucht. Mutters erste Worte waren stets: „Habt ihr eure Hände gewaschen? Los, ab, Hände waschen!“ Wenn sie dann nicht binnen Sekunden das Wasser rauschen hörte, gab es Ärger. Morgens vor der Schule gab es die gleiche Hygiene-Inspektion: „Hast du dein Gesicht gewaschen? Deine Füße? Zwischen den Zehen? Die Ellenbogen?“ Darauf folgte der Lackmustest: Sie fuhr uns mit einem in Alkohol getauchten Wattebausch über den Nacken. Wenn der sich grau färbte, waren wir nicht sauber genug. „Geh noch einmal ins Bad und wasch dich richtig.“ Wenn wir Schokoladenkuchen oder einen Keks haben wollten, mussten wir zunächst unsere Hände vorzeigen. „Aber ich habe sie vorhin erst gewaschen!“, protestierte ich oft. „Du hast aber Türklinken angefasst, Junge – geh und wasch sie dir noch mal!“
Kleidungsstücke wurden höchstens zwei Tage hintereinander getragen, dann wurden sie gewaschen und gebügelt. Niemand aus unserer Familie ging je mit einer Knitterfalte oder einem Fleck auf dem Hemd auf die Straße. Mit sechs Jahren wusste jeder von uns, wie er bei der Wäsche mit anpacken konnte. Das gehörte einfach zu der perfekten Ordnung, die man brauchte, wenn man so viele Kinder – und das damit einhergehende Chaos – im Griff behalten wollte.
Als ich 2007 ins Big-Brother-Haus in Großbritannien einzog, machten sich alle darüber lustig, wie sehr ich von Hygiene besessen war und dass ich meine Mitbewohner dauernd fragte, ob sie sich auch die Hände gewaschen hätten, bevor sie das Essen zubereiteten. Meine Frau Halima überraschte das nicht. Ihr zufolge habe ich eine „Keimphobie“, und das kann ich kaum bestreiten. Bis heute fasse ich in einer öffentlichen Toilette keinen Türgriff an, weil ich weiß, wie viele Männer sich eben nicht die Hände waschen. Auch berühre ich in öffentlichen Gebäuden keine Treppengeländer oder Rolltreppenhandläufe. Und wenn ich mein Auto betanke, dann lege ich ein Taschentuch um den Griff des Zapfhahns. Im Hotel wische ich die Fernbedienung für den Fernseher erst einmal mit Alkohol ab, bevor ich sie benutze. Ich erwarte von jeder Oberfläche eine Seuchenattacke.
Michael war genauso. Als seine Fans noch richtig nahe an ihn herankommen konnten, machte er sich sogar Sorgen wegen der Stifte, die sie ihm für die Autogramme reichten. Aber seine Neurose konzentrierte sich vor allem auf Keime in der Luft. Die Leute machten sich lustig darüber, dass er oft einen Mundschutz trug, und es wurde viel darüber spekuliert, ob er damit schönheitschirurgische