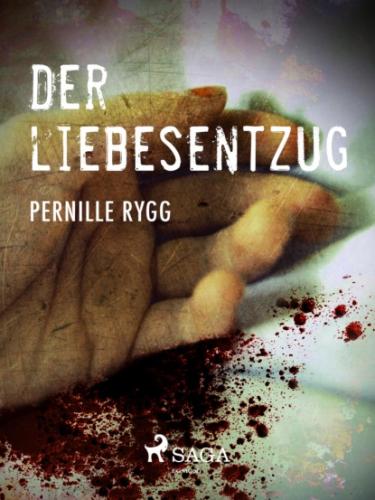Der Liebesentzug. Pernille Rygg
mit schwarzen Seiten, von denen mehrere leer sind, es ist das einzige Album, abgesehen von dem, mit den Bildern von mir, das sie noch nicht vollgeklebt hat. Es gehört in eine Zeit, als Kamera und Film noch vorsichtig behandelt wurden, die Anzahl der Fotos ist bescheiden, so wie auch ihre Größe, sie sind so winzig, diese Schwarzweißbilder, die Menschen darauf sind bloße Andeutungen. Ihre Kleider, das Haus, vor dem sie stehen, das Auto, an das sie sich steif und abwartend anlehnen, das alles ist viel deutlicher zu sehen als ihre Gesichter.
Auf einem Bild hält Ivar einen Rechen in der Hand, er hat sich die Hemdsärmel hochgekrempelt, Ragnes Mutter steht ein Stück hinter ihm, die Kamera hat sie eingefangen, als sie gerade die Augen zukneift. Sie scheint im Stehen zu schlafen, der Schlaf einer Halbdebilen.
Aber es gibt auch ein Studioporträt von ihm, eine gedämpfte, retuschierte Nahaufnahme eines Neunzehnjährigen mit feucht gekämmter und vielleicht doch ein wenig kühner Frisur. Er hat Ragnes stumpfe Nase, oder sie seine, und außerdem den gleichen Mund mit der etwas schweren Unterlippe, die seinem Gesicht sogar dann etwas Schmollendes gibt, wenn er lächelt. Ein steifes Studiolächeln. Aber mit Augen, die direkt in die Kamera schauen. Die sie vielleicht herausfordern. Er hat noch keine Tochter, dieser junge Mann.
Sie findet, dass ich meinen Namen in meine Bücher im Regal schreiben soll. Sie hat das mit ihren gemacht, also kann es ohnehin keine Verwechslungen geben, aber trotzdem. Das ist praktisch. Wenn kein Name in den Büchern steht, vergessen die anderen, sie zurückzugeben, wenn sie sie ausgeliehen haben, sagt sie. Sie hat damit bittere Erfahrungen gemacht. Eine Exi hat noch immer zwei Bücher von ihr. Die Titel weiß sie genau.
Es riecht ein wenig nach feuchtem Hund, als ich ein spätes Abendessen koche, ich habe ein Feuer im Ofen gemacht, und bald werde ich nur noch den Geruch von Holz, Rauch und Asche wahrnehmen, der Hund wird im Halbkreis aus Wärme auf dem Boden schlafen, während sein Fell trocknet. Ich schneide Zwiebeln und Kürbis in Scheiben, Paprika in lange Streifen. Ich arbeite ziemlich langsam, ich habe Zeit genug, denn Ragne hat Spätschicht.
Aus der Stadt wird angerufen, sie sind besorgt. Sie sind besorgt und machen vorsichtig darauf aufmerksam. Mutters Stimme klingt heiser und hektisch, sie wirft die Wörter durcheinander und beendet ihre Sätze nicht. Irgendwo hinter ihr im Wohnzimmer steht Vater, ich kann ihn ab und zu etwas murmeln hören, was sagt sie, fragt er, wie geht es?
Mutter versucht diskret zu sein, aber sie hat ganz offenbar mit meiner Schwester Ylva über mich diskutiert, und ich ahne schon, dass sie im Laufe dieser Diskussion zu einer gemeinsamen Überzeugung gelangt sind, aber sie haben nicht vor, die mit mir zu teilen.
»Das musst du selbst entscheiden«, sagt Mutter, und das ist so ungefähr der einzige vollständige Satz, den sie hier abliefern kann.
Margrete ist nicht ganz so diskret, wenn sie anruft. Sie verweist dann auf eine Art ungeschriebenes Gesetz für Freundschaften, wo einer der mutmaßlichen Paragrafen sich auf die Pflicht bezieht, ein feedback zu geben.
»Dafür sind wir doch da«, sagt sie. »Als Korrektiv.«
Ich höre mir ihre Korrektive höflich an und finde mich in Margretes Sorge ziemlich korrekt nacherzählt und frage mich, ob sie, aus Gründen, aus denen ich hier bin zum Beispiel, geheimnisvolle Muster hervortreten sieht, sieht, wie mein Versagen und meine Niederlagen meinen neuen Alltag prägen und ihm eine düstere Bedeutung geben. Auch ich mache mir Sorgen, wenn ich auf diese Weise mit Margretes Sozialberaterinnenstimme nacherzählt werde.
Ich segele, denke ich, ich lasse mich von Wind und Wetter treiben und andere für mich handeln, ich ergreife weder den Tag noch die Stunde noch eine helfende Hand. Solche Ausdrucksweisen entlehne ich bei Margrete, als eine Art Sozialarbeiterinnenpoesie. Dieser Gedanke hat fast etwas Anheimelndes, auch wenn es nicht meine Ausdrucksweise ist. Es ist nichts Neues, keine heftige Entdeckung.
Und es stimmt ja auch wohl nicht ganz. Dass ich hier bin, ist zumindest meine eigene Entscheidung. Mit Margretes sanfter Stimme oder Mutters unvollständigen Sätzen konfrontiert, werde ich von ihnen angesteckt, und wenn ich allein bin, hängt noch ein Rest ihrer Unruhe in mir, hat sich in meinem Körper niedergelassen und wird in eine Art kindischen Trotz verwandelt. Das weiß ich, ich weiß, dass der Trotz mit ihrer Besorgnis zusammenhängt, und dass auch er nach einiger Zeit verfliegen wird, nach einigen Minuten schnellen Laufens oder einer Tasse Kaffee, wie das auch mit der Unruhe der Fall ist.
Ich hätte ihnen vorhalten können, dass in ihrer Unruhe etwas Ungerechtes liegt, dass ich durchaus versuchen kann, ihren Ratschlägen zu folgen, Silje abzuhaken, weiterzugehen, dass ich hier bin, weil ich den Vorschriften für das erwachsene Leben folge. Das könnte ich tun. Ich könnte widersprechen. Aber ich tue es nicht. Der bloße Gedanke daran macht mich schon müde. Und ich versuche allem auszuweichen, was mich müde macht. Er könnte sich fast als Projekt bezeichnen lassen, dieser Versuch, nicht müde zu werden.
Deshalb überhöre ich die Besorgnis, wenn sie als kleiner Wink abgeliefert wird. Wird sie ausgesprochen, beruhige ich. Auf diese Weise kann ich es verhindern, müde zu werden, indem ich die Worte nicht umdrehe und der Unruhe nicht antworte, die sich vor allem in der Stimme manifestiert, im Klang. Ich versuche, nicht zu deuten. Das geht ziemlich gut.
Es ist mir lieber so. Deshalb kann ich auch die Vertretungsstunden übernehmen. Weil sie in den ersten Schuljahren stattfinden und keinerlei Deutung verlangen. An irgendeiner Stelle liegt natürlich auch der Stoff, den ich diesen kleinen Schulkindern beibringen soll, das Ergebnis einer menschlichen und veränderlichen Entscheidung, wie die Welt zu deuten ist, aber das brauche ich ihnen nicht zu erzählen. Es bedeutet einen Ozean an Unterschied. Das hatte ich nicht erwartet, aber so ist es.
Ich kann sie verlassen und von nichts anderem müde sein als dem Lärmpegel und ihrer ganz natürlichen Konzentrationsunfähigkeit. Es ist kaum schlimmer, als mich nach einem Spaziergang mit dem Hund müde zu fühlen. Das macht mir nicht viel aus.
Sie sind kleine kompakte Geschichtspakete, diese Kinder, aber sie deuten sich nicht, jedenfalls nicht bewusst, und darauf kommt es an. Was mich müde macht, sind die Deutungen. Auch Ragne ist natürlich so ein kompaktes Paket. Aber auch sie deutet nicht. Ragne braucht das nicht, denn sie weiß: Die Kinder können es nicht, weil sie nichts darüber wissen. Egal, was die Ursache sein mag, für mich ist es eine Befreiung.
Ich bin dreißig und müsste eigentlich am Gymnasium Geschichte unterrichten. Aber die Fahrt in die Innenstadt ist zu weit, um sie jeden Tag zurückzulegen. Das ist jedenfalls die offizielle Begründung dafür, dass ich hier im Ort an der Grundschule Vertretungen übernehme, es ist der Grund, den ich Mutter und Margrete gegenüber anführe. Und Ragne gegenüber übrigens auch.
In Wirklichkeit genieße ich diese Arbeit. Ich ertrage es nicht nur, ich genieße es, nach einem Schultag so müde zu sein, wie sich das gehört, auch wenn es nicht dieselbe behagliche Erschöpfung ist, die die Waldspaziergänge mir bringen, sondern mich im Gegenteil ab und zu nervös und ein wenig jähzornig macht.
Manchmal komme ich damit zu Ragne nach Hause, mit dieser Müdigkeit, die vielleicht Ähnlichkeit mit einem vagen Kopfschmerz hat, und ich bin kurz und schroff, wenn ich mit ihr spreche oder wenn sie mich anspricht.
»Was ist los?«, fragt sie dann endlich.
»Gar nichts«, sage ich.
Und das stimmt ja auch. Es stimmt jedenfalls mehr als viele andere mögliche Antworten. Wenn ich ein seltenes Mal diese Vagheit mit mir nach Hause nehme, kann ich sie am Herd auflösen – mit meinen kleinen Plastikschüsseln und der pflegeleichten Teflonpfanne – oder zwischen den Bäumen, mit Frigg an der Leine. Sie ist nicht von Dauer und lässt sich durchlöchern, in der Regel schon im Lehrerzimmer, vor Ende des Schultages. Allen anderen geht es ähnlich, sie haben Wolle im Kopf und vielleicht einen Hauch von Mundgeruch, sie haben feuchtkalte, kreidefleckige Hände wie ich und sind resigniert, wie ich es bin, weil die Kinder ihre Hausaufgaben nicht machen und uns immer wieder Einblick in ihr seltsames Familienleben gewähren.
»Ich fass es nicht«, kann zum Beispiel Berit kurz vor Feierabend sagen. »Ich habe sie mindestens fünfmal darum gebeten, darauf zu achten, dass er seine Aufgaben macht, aber sie vergessen es einfach. Und die wollen seine Eltern sein!«
Kreideflecken