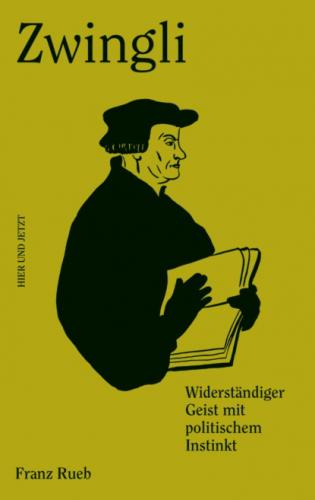Zwingli. Franz Rueb
diese reagierte nicht.
Nun waren die Franzosen zahlenmässig in noch weit stärkerer Übermacht. Die Gegner hatten viel mehr Artillerie, also Kanonen, und weit mehr Krieger. Die Eidgenossen verloren in der folgenden Schlacht mehrere Tausend Mann. Die eidgenössischen Krieger setzten auf die falschen Kriegsmittel, sie waren mit ihren Hellebarden waffentechnisch unterlegen und wurden zudem taktisch übertölpelt. Aber sie hatten auch keine Einigkeit, keine Moral, keine Disziplin, noch konnten sie sich auf ihre übliche Schlagkraft verlassen. Das föderalistische System der Eidgenossenschaft, das muss man so sagen, war Nährboden für Gespaltenheit. Die Gier nach Eroberungen und nach Beute der Krieger lockte sie zu militärischen Ausschweifungen nach Oberitalien. Sie wurden grossmachtsüchtig und sie rannten fast blind ins Verderben. Unter den Schweizer Söldnern drohte sogar ein Bruderkrieg.
Zwingli hatte wohl gegen die Spaltung des eidgenössischen Heeres gepredigt, wie der Zuger Ammann Werner Steiner als Chronist festhielt. Hätte man auf Zwingli gehört, wäre diese Katastrophe nicht über die Schweizer hereingebrochen, meinte der Chronist.
1516 unterzeichneten die Eidgenossenschaft und Frankreich in Freiburg einen Friedensschluss. Franz I. warb weiterhin Schweizer Söldner an. Nur der Stand Zürich machte bei dem Bündnis mit Frankreich nicht mit. Zwar war die Expansionspolitik der Tagsatzung mit der Niederlage in Marignano zu Ende. Aber die Soldbündnisse, die Söldnerei, die Reisläuferei nahmen ihren Fortgang vor allem für die französischen Könige. Einheitliche Positionen waren allein schon durch die Reformation in der Eidgenossenschaft nicht mehr möglich, denn es gab fortan eine katholische und eine reformierte Schweiz und weit und breit keine Einheit.
Die Erfahrungen in der furchtbaren Schlacht bei Marignano als den Beginn der Neutralitätspolitik der Eidgenossenschaft zu sehen, ist eine heuchlerische, unschöne Mär. Die Soldbündnisse mit dem französischen Staat hielten an, die Reisläuferei junger Schweizer Männer ging noch lange weiter, die Abhängigkeit von der Kurie in Rom wie von Frankreich reichte bis zu Napoleons Zeiten. Da ist nirgends ein Hauch von Neutralität. Eigentlich sind Zwingli und dann durch ihn der Stand Zürich die ersten und lange die Einzigen, die diesem Geschwür der fremden Dienste und der fremden Gelder konsequent den Kampf ansagten. Zwingli sah den Blutzoll, das Elend und die Verrohung seiner Landsleute. Es dauerte noch mindestens bis zum Jahr 1648, dem Westfälischen Frieden nach dem Dreissigjährigen Krieg im Heiligen Römischen Reich, bis die Vision einer Neutralität in der Schweiz Form anzunehmen begann. Und erst 1815 durch die Resultate des Wiener Kongresses wurde sie vollends konkret.
Vor der Schlacht in Marignano tauchte im Lager der Schweizer der Walliser Kardinal Schiner auf, der zur allgemeinen Verunsicherung unter seinen Landsleuten gehörig beitrug. Zwingli hatte ja bereits jahrelange Erfahrung mit dem fremden Solddienst, er beobachtete und kommentierte schon lange die Grossmachtpolitik der Schweizer und ihre Dienste bei fremden Mächten. Er wird auch hier in dieser Predigt, unmittelbar vor der Schlächterei, nicht mit klaren Worten gespart haben. Und hinterher, nach dem grossen Gemetzel, verabscheute er für immer den Solddienst, gegen den er jahrelang einen Kampf geführt hat. Er sprach von «Kriegsgurgeln, von Blutkrämern, von schandbarem Schacher […] die den Schweizer mit jungem Blut treiben liessen, für den schnöden Mammon». Für Ludwig XII. seien 5000 Schweizer in Neapel umgekommen. In Novara seien 1500 gefallen. In Marignano seien über 6000 liegen geblieben. Die Schweizer seien in ihren eigenen kriegerischen Auseinandersetzungen immer siegreich geblieben, in fremden Diensten aber oft sieglos. Die Vorfahren hätten sich für Freiheit geschlagen. Bei den fremden Herren gehe es nur um Geld. Unter dem Eindruck der Katastrophe von Marignano hat Zwingli 1516 begonnen, das Evangelium zu predigen. Schon Jahre vorher hat er eingesehen, dass «Kriegführen im Sold fremder Herren unmenschlich, schamlos und sündhaft sei».
DIE WENDE 1516
Es erstaunt immer wieder bei der Lektüre von Zwinglis Texten, wie es dieser fertigbrachte, unreligiös zu schreiben, vor allem in seinen geschichtswissenschaftlichen Studien. Es gibt kaum Sätze, die auf einen Prediger hinweisen würden. In seiner Glarner Zeit bedient sich Zwingli fast ausschliesslich einer Sprache, die einem umfassend gebildeten humanistischen Gelehrten entsprach. Genau das entzückte den Glarner Humanisten Glarean, der gerade in Köln seinen Magister machte und im Sommer 1510 dem Pfarrherrn nach Glarus folgenden begeisterten Brief sandte: «Welch willkommenes Geschenk sind mir die Briefe von dir, du fein gebildeter humanissime Mann! Nichts sehe ich lieber, nichts ersehne ich mehr; sprudeln und strömen und überfliessen sie doch so unendlich reich allüberall von jeder Zier, jeglicher Anmut und Würze. Lese ich sie, so könnte ich in Verzückung geraten und in Traumbildern schwelgen. Denn hier leuchtet so viel gewichtiger Inhalt auf, hier bricht so viel rednerischer Schmuck hervor und streichelt einem dann wieder derartige Klangschönheit das Ohr, dass man wirklich nicht weiss, wem von ihnen die Palme zu reichen ist.»
Und am 18. April 1511 schrieb Glarean aus Köln, er wolle zur Glarner Kirchweih in seine Heimat kommen. Den lateinisch geschriebenen Brief beendete er deutsch mit den Worten: «Wenn ich kum, so wollen wir guter Dinge syn.» Der Besuch fand wirklich statt, denn noch im gleichen Jahr schwärmte Glarean von den herrlichen Stunden, die er mit und bei Zwingli verbracht habe. Sie hatten so vieles gemeinsam: ihre Herkunft, ihre Liebe zur Musik und zu den antiken Autoren.
Und zudem war dieser Kirchherr in Glarus ein stattlicher Mann, wie ihn Zeitgenossen beschrieben, «sein Angesicht freundlich und rotfarben». Er hatte eine melodische Stimme, nicht allzu kräftig, aber fesselnd für die Gemeinde. Im Nu waren die Zuhörer in seinem Bann.
Der Lesehunger Zwinglis war trotz starker Inanspruchnahme durch sein Amt beinahe unersättlich. Vadian, der St. Galler Gelehrte und Freund, nannte ihn einen «eifrigen Liebhaber der guten Literatur». Mehrere der gelehrten Männer der Zeit, mit denen Zwingli in Briefverkehr stand, rühmen ihn für seine Briefe. Er stand mit den Offizinen von Froben in Basel, Lachner und Furter, in ständiger geschäftlicher Verbindung, denn er lebte ja etwas abseits der gelehrten Zentren Basel, Zürich, Köln und Frankfurt.
Er entwickelte eine Schau vom Heil erwählter Heiden, die Schilderung vom himmlischen Gastmahl, an dem alle Heiligen, Weisen, Gläubigen, Standhaften, Tapferen, Tüchtigen teilnehmen, die es seit Erschaffung der Welt gab: das heisst neben den Patriarchen, Aposteln und Heiligen des alten und neuen Bundes auch Herkules, Theseus, Sokrates, Aristides, Antigonus, Numa, Camillus, die Catonen, die Scipionen oder die französischen Könige. Diese Vision hatte schon das Entsetzen Luthers ausgelöst. Theologisch ist sie jedoch nicht «ein Einbruch in die Ausschliesslichkeit christlichen Heilsbewusstseins, den Menschen wertend, ein Stück Wiederbelebung des klassischen Altertums».
Nun bewegte sich Zwingli langsam von seiner festgefügten Katholizität weg. Er begann immer stärker an der katholischen Heilslehre zu zweifeln.
Er kam auch noch Jahre später mehrmals auf seine Entwicklung zu sprechen, bei diesen Bekenntnissen bezeichnete er das Jahr 1516 als den entscheidenden Auslöser zu seiner religiösen Wende, also noch ein Jahr vor Luthers Thesenanschlag. In einer Schrift geht er dann auch später darauf ein und hält fest, er habe die Lehre Christi aus ihrem eigenen Ursprung zur Kenntnis genommen und verinnerlicht, und zwar zu einer Zeit, als ihm Luther noch gar nicht bekannt gewesen sei. Das ist eine wichtige Äusserung zu seiner religiös-reformatorischen Eigenständigkeit. Und ein andermal schreibt er: «Ich habe angefangen das Evangelium zu predigen im Jahr 1516.» Also hat er noch in Glarus diese Wende geschaffen, die neue Art zu predigen hatte wohl hineingepasst in seinen bevorstehenden Wechsel nach Einsiedeln. Und bereits im Frühjahr 1516 erkundigte er sich in Basel nach dem dort erschienenen griechischen Neuen Testament des Erasmus. Nach seinem eigenen Verständnis war Zwingli also im Jahr 1516 wie neu geboren. Sein Erlebnis des Evangeliums muss gewaltig gewesen sein. Ihm öffnete sich eine ganz neue innere Welt: das Neue Testament. Von nun an war das für ihn das Zentrum. Es gab nichts Vergleichbares für ihn. Er trieb Politik, er machte Musik, er befasste sich mit den Griechen und Römern. Aber was das Evangelium ihm bedeutete, das war für ihn von einer Kraft und Ausstrahlung, dass er nicht anders konnte, als alles für diese Entdeckung zu verlangen, was er überhaupt nur verlangen und geben konnte. Er war ausserstande zu begreifen, dass die Innerschweizer Orte sich weigerten, sich dem Evangelium anzuschliessen. Darin ist Zwinglis Mission für die ganze Eidgenossenschaft zu begründen. Das ist der Kern für Zwinglis Bereitschaft zu