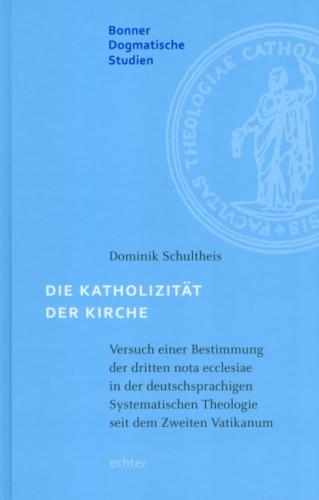Die Katholizität der Kirche. Dominik Schultheis
Eine ähnliche Konzeption liefert die Offenbarung des Johannes (vgl. Offb 7,4–8; 14,1–5; 21,12ff). Das Matthäusevangelium sieht in Jesus in erster Linie den Messias des Volkes Gottes (vgl. Mt 1,21; 2,6; 4,23), das ihn jedoch nicht erkennt und letztlich ablehnt (vgl. Mt 27,25; 28,15). Eine Substitution Israels durch die Kirche als neues Volk Gottes (λαὸς καινός) jedoch findet sich erst in nachapostolischer Zeit (vgl. Barn 5,7; 7,5; 13,1)406.
2.2Theologiegeschichtliche Verwendung von „Volk Gottes“
In der frühen Theologie bis hin zu Augustinus spielte die biblische Metapher vom „Volk Gottes“ für das Verständnis der Kirche eine zentrale Rolle. So verwendet die Alte Kirche den Volk-Gottes-Begriff in selbstverständlicher, jedoch durchaus unterschiedlicher Weise407: Einerseits wird er polemisch zur Abgrenzung vom Judentum verwendet (vgl. Barn. 5,7; 7,5; 13,1; Iust. dial. 135; Clem. Alex. paed. I, 19,4; 20,3); andererseits betont er gerade die Kontinuität zwischen der christlichen Kirche und dem Volk Israel, wenn die Kirche als „ecclesia ab Abel“ (Aug. serm. 341; cov. XVIII, 51) verstanden wird. Daneben dient der Begriff auch zum Ausdruck des kirchlichen Selbstverständnisses als des von Gott in Christus im Heiligen Geist gesammelten „neuen“ und endzeitlichen Volkes Gottes (Cypr. ep. 63; domin. or. 8; CatRom 1761,81). Im Bereich der Liturgie und der Kirchenordnung bezeichnet der Begriff „Volk“ von den Anfängen (Iust.1 apol. 67) bis heute (SC 14) die versammelte Gemeinde im funktionalen Unterschied zu den Leitern der Gemeinde bzw. Gottesdienstvorstehern.
Im Mittelalter avanciert der Volk-Gottes-Begriff zum Rechtsbegriff und dient der Gegenüberstellung von Hierarchie und Kirchenvolk; als Selbstbezeichnung der Kirche gerät der Volk-Gottes-Begriff zunehmend in Vergessenheit, tritt die vom Volk-Gottes-Begriff bestimmte Selbstreflexion der Kirche doch komplett hinter den nun in den Vordergrund tretenden Begriff vom „mystischen Leib Christi“ zurück, der fortan als der wesentlichste Titel der Kirche gilt. Diese Entwicklung setzt sich in der Theologie der Gegenreformationen fort, so dass der Volk-Gottes-Begriff gänzlich aus der Theologie über die Kirche verschwindet.
Eine theologische Rückbesinnung auf den biblischen und patristischen Ursprung des Volk-Gottes-Begriffs im 20. Jahrhundert half, das Verständnis der Kirche als Volk Gottes wiederzuentdecken und damit das heilsgeschichtliche Verständnis der Kirche erneut zu betonen.408 Wesentlich dazu beigetragen haben Arbeiten von Yves Congar409 sowie Mannes Dominikus Koster410. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil wurde an dieser Neurezeption des Volk-Gottes-Begriffs mit Entschiedenheit weitergearbeitet.411
2.3Neurezeption des Volk-Gottes-Begriffs auf dem Konzil: Das Volk-Gottes-Sein der Kirche als Erweis ihrer Katholizität
Die vom Zweiten Vatikanischen Konzil aufgegriffene Selbstbezeichnung der Kirche als „Volk Gottes“ will das Selbstverständnis einer „societas perfecta“ aufgeben zugunsten eines entgrenzten Kirchenverständnisses, nach dem der Sinn der Kirche – trotz und wegen ihrer Sakramentalität – nicht allein in ihr selbst liegt, sondern im universalen Heilswillen Gottes, der die ganze Schöpfung heimholen will zur Vollverwirklichung seiner Gottesherrschaft.412 Kirche als Volk Gottes zeichnet sich nach Meinung der Konzilsväter nämlich gerade dadurch aus, dass sie sich – weil auf die Heimholung der gesamten Schöpfung bleibend ausgerichtet und aufgrund ihrer Sakramentalität (s.u.) – als eschatologische Größe weiß, als endzeitliches Volk Gottes, das erst noch vollendet werden muss und in dieser Vollendung seine restlose Absolutheit erhält. Als diese eschatologische Größe ist die Kirche ein pilgerndes Volk auf dem Weg, ein Volk, das „auf die Parusie des Herrn als zukünftige dadurch wartet, dass sie die Parusie des Herrn als gegenwärtige in sich trägt.“413 Gerade hierin erweist sich ihre Katholizität:
Weil die Kirche die Herbeiführung der Gottesherrschaft ist, muss sich die Kirche als Volk Gottes „in geschichtlicher Entwicklung […] auf Erden ausbreiten. So ergibt sich die universal-menschheitliche Bedeutung dieses Volkes. Die ‚kleine Herde’ birgt für die gesamte Menschheit lebendige Kräfte der Einigung und der steten Aufwärtsbewegung zum Heil in sich […]. In Christus wird sie zur Vermittlerin der Erlösung an die ganze Welt. […] [Denn] das Subjekt des Heils, an das Gottes Erbarmen sich wendet, ist zunächst immer das Volk, die Gesamtheit der Völker, ist die Kirche als der Partner des Bundes, und der Einzelne immer nur als Glied an diesem Volk der Verheißung […]. Alle Heilswege Gottes führen in die Gemeinschaft.“414
Die qualitative, intensive Katholizität, die das Entscheidende ist, drängt zu ihrer quantitativen, extensiven Katholizität. Weil die Kirche als Gottes auserwähltes Volk katholisch ist, weil sie von Christus her die Fülle des Lebens und der Gnade, die Ganzheit der Offenbarung Gottes in Christus im Heiligen Geist als gegenwärtig in sich trägt, kann sie sich nicht mit sich selbst begnügen. Vielmehr muss sie die in sich tragende Fülle und Vollkommenheit Christi, d.h. ihre qualitative, intensive Katholizität, weiter vermitteln und muss immer wieder in die missionarische Dynamik des Sauerteigs, der den ganzen Teig durchdringt, finden.415 Anders gesagt: Weil die Kirche in einer strukturellen Kontinuität zu Israel als Volk Gottes das Ganze, die Fülle des Heils in sich trägt (qualitative Katholizität), kann sie, wenn sie „ganz“ katholisch sein und bleiben will, diese Fülle nicht für sich allein behalten, sondern muss von ihrer intensiven Katholizität auf die extensive Katholizität hindrängen, d.h. Kirche aller Völker und aller Kulturen sein (quantitative Katholizität). Kirche muss, um ihrem Volk-Gottes-Sein, ihrer Katholizität, gerecht zu werden, „von der Erkenntnis beseelt sein, dass die Gabe, die ihr geschenkt wurde, ihr zum Weitergeben übertragen worden ist; dass sie diese Ganzheit veruntreuen würde, wenn sie sie nicht hintragen würde ‚zu jeder Kreatur’ (Mk 16,15)“416.
LG 13 entfaltet diese Katholizität der Kirche als des universalen Volkes Gottes. Ihr Wesen bestimmt sich aus dem Leben des Volkes Gottes in der ihm innewohnenden Dialektik zwischen Einheit und Vielheit, in der Spannung zwischen seiner Berufung zur Sammlung des endzeitlichen Gottesvolkes (Einheit und Einzigkeit) und seiner Sendung zu allen Menschen aller Orten und Zeiten (Vielheit, Universalität). Das Konzil versteht die Katholizität der Kirche als ein Ausbreiten des einen Volkes unter allen Völkern der Erde (quantitative, extensive Katholizität) dergestalt, dass alle Gläubigen miteinander in Gemeinschaft (communio) stehen, und zwar mit der ganzen pneumatischen Fülle, die dem Gottesvolk zu eigen ist (qualitative, intensive Katholizität).417 LG 13 betrachtet die extensive Katholizität des Volkes Gottes schließlich unter zwei Blickrichtungen: zunächst mit Blick auf die ganze Menschheit, dann mit Blick auf die innere Verfasstheit der Kirche:
„In ihr [ihrer Weltweite, das meint ihrer extensiven Katholizität] strebt die katholische Kirche mit Tatkraft und Stetigkeit danach, die ganze Menschheit mit all ihren Gütern unter dem einen Haupt Christus zusammenzufassen in der Einheit seines Geistes […]. Kraft dieser Katholizität bringen die einzelnen Teile ihre eigenen Gaben den übrigen Teilen und der ganzen Kirche hinzu, so dass das Ganze und die einzelnen Teile zunehmen aus allen, die Gemeinschaft miteinander halten und zur Fülle in Einheit zusammenwirken [= intensive Katholizität]. So kommt es, dass das Gottesvolk nicht nur aus den verschiedenen Völkern sich sammelt, sondern auch in sich selbst aus verschiedenen Ordnungen gebildet wird. Unter seinen Gliedern herrscht eine Verschiedenheit, sei es in den Ämtern, […], sei es in Stand und Lebensordnung […]. Darum gibt es auch in der kirchlichen Gemeinschaft zu Recht Teilkirchen, die sich eigener Überlieferungen erfreuen, unbeschadet des Primats des Stuhles Petri, welcher der gesamten Liebesgemeinschaft vorsteht […], die rechtmäßigen Verschiedenheiten schützt und zugleich darüber wacht, dass die Besonderheiten der Einheit nicht nur nicht schaden, sondern ihr vielmehr dienen. Daher bestehen schließlich zwischen den verschiedenen Teilen der Kirche die Bande einer innigen Gemeinschaft der geistigen Güter, der apostolischen Arbeiter und der zeitlichen Hilfsmittel. Zu dieser Gütergemeinschaft nämlich sind die Glieder des Gottesvolkes berufen, und auch von den Einzelkirchen gelten die Worte des Apostels: ‚Dienet einander, jeder mit der Gnadengabe, wie er sie empfangen hat, als gute Verwalter der vielfältigen Gnadengaben Gottes’ (1 Petr 4,10).“418