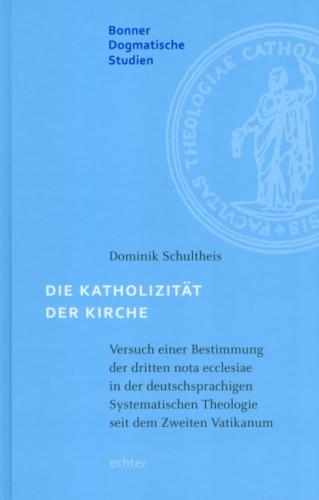Die Katholizität der Kirche. Dominik Schultheis
und Fortschreibung der konziliaren Lehre über die Kirche vorankommt.
Widmen wir uns nun dem vom Konzil entfalteten Selbstverständnis der Kirche. Die Frage nach diesem bliebe unvollständig, würde nicht nach seinem theologischen Fundament gefragt: Welches Gottesbild hat das Konzil seinen ekklesiologischen Aussagen – vornehmlich dem von der Sakramentalität der Kirche – zugrunde gelegt? Dieser Frage soll im Sinne eines Präludiums kurz nachgegangen werden.
1. Der trinitarische Rahmen konziliarer Ekklesiologie
Bereits der erste Satz der Kirchenkonstitution macht deutlich, dass das Konzil einen Kirchenbegriff zugrunde legt, der einen rein auf das empirisch Sichtbare von Kirche beschränkten Begriff übersteigt. Das Konzil betrachtet die Kirche vielmehr von Christus her:
„Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten“ (LG 1).
Das Licht, das Christus ist, ist auch das Licht der Kirche („lumen ecclesiae“), und in Christus ist die Kirche das Licht der Völker („lumen gentium“).384 In diesem programmatischen Leitwort, das Johannes XXIII. wiederholt verwandte, um die Idee des Konzils zusammenzufassen385, strahlt ein Motiv der Vätertheologie auf: Hier sprach man gern von der Kirche als dem „mysterium lunae“. Damit wollte man ausdrücken, dass die Kirche – wie der Mond – nicht vom eigenen Licht her strahlt, sondern Christus widerspiegelt, der ihre Sonne ist.386 Damit ist ein erstes Vorzeichen gegeben, von dem aus sich die ekklesiologischen Aussagen des Konzils erschließen: Dessen „Ekklesiologie erscheint abhängig von der Christologie, ihr zugehörig.“387
Ein Zweites ergibt sich notwendig aus dem Ersten: Jede Rede von Christus, dem Sohn, sagt zugleich – will sie nicht enggeführt sein – den Vater aus und damit die Beziehung zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. Das Konzil ordnet demgemäß seinen christologischen Ansatz in den Gesamtrahmen der Trinitätstheologie ein (vgl. LG 2–4) und versteht die Kirche als „Ikone der Trinität“388, als Widerschein der göttlichen Communio. „Die christologische Sicht der Kirche [weitet sich] notwendig in eine trinitarische Ekklesiologie aus“389. Auf der Folie des vom Konzil zugrunde gelegten trinitarischen Gottesverständnisses entfaltet es eine, von innen her eucharistisch bestimmte Communio-Ekklesiologie, nach welcher sich die innertrinitarische Dialektik von Einheit und Vielheit in der Kirche als „Sakrament“ (LG 1, 9, 48, 59) der göttlichen Einheit – sowohl in ihrer eigenen Verfasstheit (intensive Katholizität) wie auch in ihrem Dienst an der universalen Versöhnung der gesamten Schöpfung (extensive Katholizität) – widerspiegelt: „So erscheint die ganze Kirche als ‚das von der Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk’“ (LG 4). Diese sakramentale Sicht ermöglicht, die untrennbare Einheit und gleichzeitige unvermischte Verschiedenheit zwischen der Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus und der Kirche auszudrücken: Kirche „ist […] zuerst Setzung von oben. Sie verwirklicht sich dennoch in Welt und Geschichte“390. In schöpfungstheologischer sowie eschatologischer Perspektive erweist sich die Kirche als „allumfassende[…][s] Heilssakrament“ (LG 48), als „das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi“ (LG 3), als „Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden“ (LG 5), das „an dem universalen Heilsgeschenk Gottes [partizipiert] […][und] selbst zu einem universal anwesenden Zeichen der Liebe Gottes in der Welt“391 wird. Als Sakrament des Heils steht die Kirche selbst im Spannungsverhältnis zwischen Schon und Noch-Nicht, in der Dialektik zwischen der antizipativen Gegenwart und der Ausständigkeit des Reiches Gottes.
Im Folgenden sei das Verständnis der Kirche als „Volk Gottes“ betrachtet, dem das zweite Kapitel der Kirchenkonstitution gewidmet ist.
2. Die Bezeichnung der Kirche als „Volk Gottes“ des Neuen Bundes
Gottes universaler Heilswille zielt auf alle Menschen, denn „er hat […] beschlossen, die Menschen zur Teilhabe an dem göttlichen Leben zu erheben.“ (LG 2) Dies macht die Hl. Schrift deutlich, wenn sie mit der Erschaffung der Welt beginnt: Deren erste Gestalt nämlich ist nicht Abraham, der Stammvater des 12-Stämme-Volkes, sondern Adam, der erste Mensch. Adam bezeichnet in der Genesis jedoch nicht einen bestimmten Menschen, einen Einzelnen, sondern den Menschen überhaupt, die Menschheit.392 Damit aber liefert die Genesis den Schlüssel zum Verständnis der gesamten Bibel: Sie schildert im Alten Testament nicht nur die Geschichte einer Beziehung zwischen JWHW und seinem auserwählten Volk des Alten Bundes, die sich im NT mit Christus auf die Kirche des erneuerten Bundes ausweitet, sondern die Gemeinschaft mit Gott, sein Heilswille, zielt auf alle Völker und ist universal. Es geht JHWH nicht zunächst und primär um das eine auserwählte Volk Israel, sondern um das ganze Menschengeschlecht, das ὅλον der Schöpfung, das Ganze: die Universalität (Katholizität) seines Heils. Diesem universalen Heilswillen Gottes entsprechend nimmt das Zweite Vatikanische Konzil den Begriff „Volk Gottes“ in seiner Kirchenkonstitution als Bezeichnung für die Kirche auf und bestimmt ihn „als eine universale Größe […], zu der alle Menschen gerufen werden (vgl. LG 13) und deren Haupt Christus als ‚inkarnatorisch vermittelte Unmittelbarkeit zu Gott‘ […] ist (vgl. LG 9)“393.
Konkret verwirklicht sich das Heil Gottes für die gesamte Menschheit in der Sammlung einer Heilsgemeinde, die ihren Ursprung in der Erwählung Abrahams hat (vgl. Gen 12,1–3) und die Johannes in der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem, verwirklicht sieht (vgl. Offb 21,2.24). Das Kommen des neuen Jerusalems, einer neuen Gesellschaft, der – symbolisiert durch die zwölf Tore, welche niemals geschlossen werden (Offb 21,25) – eine weltweite Öffnung zu eigen ist (vgl. in diesem Zusammenhang die Völkerwallfahrt zum Jerusalem der Endzeit in Jes 60,1–11), ist also an einen konkreten Ort und an eine konkrete Zeit gebunden, nämlich an das 12-Stämme-Volk und dessen Geschichte.394 Gott möchte die Erlösung der ganzen Welt und beginnt mit der Veränderung der Welt auf die erhoffte neue Stadt Jerusalem hin an einer bestimmten raumzeitlich definierbaren Stelle bzw. an einem Einzelnen: Abraham. In Abraham verändert der Glaube an den biblisch bezeugten Gott JWHW die Welt in konkreter Weise. Wenn es in der Genesis heißt: „Ein Segen sollst du sein. […] Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen“ (Gen 12,2–3), dann meint dies nichts anderes, als dass Abraham und das Neue, das JWHW mit ihm in der Welt beginnen lässt, denen, die mit Abraham in Kontakt kommen, zum Heil gereichen. Bei Erwählung des Abraham geht es nicht nur um ihn und um seine Sippe, sondern um das Ganze; aber damit das Ganze erreicht wird, die ganze Schöpfung, braucht es einen konkreten Menschen an einem konkreten Ort zu einer konkreten Zeit, der von Gott erwählt und mit dem Gott seinen Heilsplan veranschaulichen kann. Dabei handelt Gott nicht ohne die Einbeziehung derer, die er erwählt und sendet: Geht die Sendung zwar von Gott aus, die sich nur im Hören und im Sich-Öffnen für dessen Auftrag und Verheißung hin verwirklichen lässt, so gebraucht Gott keine Gewalt, damit sein Plan gelingen wird; Gott handelt stets unter der Bedingung, dass die Freiheit des Einzelnen respektiert wird und der Gesandte in Freiheit dasselbe wollen muss, was auch Gott will. Abraham lässt sich auf den Anruf Gottes ein – in Freiheit – und wird so zum Stammvater des Volkes, das Gott erwählt hat: nicht für sich selbst, sondern damit die anderen in diesem einen Volk erkennen, was eine aus dem Willen Gottes lebende neue Gesellschaft ist. Gott braucht in der Welt ein konkretes, sichtbares Volk, an dem er seine neue Gesellschaft veranschaulichen kann und erwählt dieses im Sinne der Sendung für die anderen.
Wenn sich die Kirche als „ecclesia“, d.h. als die „Versammlung“, als die „Herausgerufene“, in einer Kontinuität der Sendung Israels weiß, dann ist auch sie keine Versammlung von für sich selbst auserwählten Menschen, sondern eine Versammlung derer, die als Zeuginnen und Zeugen des in Jesus Christus inkarnierten Gottes auserwählt sind für die anderen. Diese aber ist die Kirche – in einer strukturellen Kontinuität zum einen, sichtbaren, konkreten auserwählten Volk Israel – als konkrete sichtbare Versammlung, als „sichtbares Gefüge“,